Eine Buchhandlung auf 1765 Metern Höhe, ein seltsamer Gast, eine Alpendohle und ein Buch im Buch. In Heinrich Steinfests neuem Roman entfalten sich die Geheimnisse und Zufälle wortwörtlich auf vielen Ebenen. Im Gespräch mit Buchkultur erklärt der Coverautor der aktuellen Österreichausgabe, warum er der Bergmotivik so treu geblieben ist und warum er im Grunde ein Büromensch ist. Außerdem: Weshalb er dem Konzept der seinen Romanen zugrundeliegenden Kernsätze durchaus etwas abgewinnen kann, warum seine Leser/innen seine Bücher verwandeln können, warum eigentlich die ganze Welt ein Kriminalroman ist und woran er letzten Endes wirklich gescheitert ist. Foto: Burkhard Riegels.
Buchkultur: Das Motiv des Berges kommt nicht zum ersten Mal in Ihrem Werk vor – diesmal ist es titelgebend – und mehr. Woher kommt die Faszination für die Befassung mit dem Berg?
Heinrich Steinfest: Also zunächst hat das ganz einfach ästhetische Gründe. Hat man schon einmal einen hässlichen Berg gesehen? (Ich hoffe, ich werde jetzt nicht mit Fotos angeblich hässlicher oder besonders hässlicher Berge in der Art besonders hässlicher Katzen und Hunde bombardiert.) Die Gestalt der Berge zieht mich an, so absurd und sinnlos es erscheinen mag, sich ihnen anders zu nähern als durch reine Betrachtung. Ich bin zwar mitten in Wien aufgewachsen, im vierten Bezirk, aber Tag für Tag die Argentinierstraße hinauf- und hinuntermarschiert, die hat bei uns Kindern auch wirklich »Argentinierberg« geheißen und führt ja in der Tat recht steil von der Elisabethkirche zum Funkhaus hinunter. Mein erster Berg, gewissermaßen als Straße verkleidet.
Im aktuellen Roman hat der Berg natürlich den Sinn und Zweck, zur novellenartigen Verdichtung beizutragen. Er ist eines der Naturmotive. Und hat mir geholfen, die Figuren von der Welt zu isolieren, um eine größere Konzentration auf das zu erreichen, was sie sind und auf das, was sie verbergen. Die Natur in ihren Erscheinungsformen – der Berg also, der Schnee, die Lawine, das Tier in Gestalt einer Alpendohle, letztlich die Wolke – verfügen über jene magische Kraft, um bei den handelnden Personen Bewusstseins- und Erinnerungsströme auszulösen, die sie zurück zur eigenen Geschichte führen. Zu dem, was wirklich geschah.
So reicht die Spannbreite meiner Berg-Geschichten von dem frühen, ersten Cheng-Roman, in dem der Protagonist seinen linken Arm in einer Gletscherspalte verliert (was, so merkwürdig es klingen mag, zu einer grandiosen Einarmigkeit und sechs Romanen führt, während gerade der siebente im Entstehen ist), über den Roman »Der Allesforscher«, in dem ich die eigene Höhenangst behandle (und auch das »Bad Berg« in Stuttgart eine Rolle spielt), der vor allem aber dem Andenken meines Bruders gewidmet ist, der dreiundzwanzigjährig als Bergsteiger tödlich verunglückte. Weiter über die milden, sanften Bergkuppen des südlichen Odenwalds in den Büchern »Die Büglerin« und »Der Chauffeur«, bis hin zum »betrunkenen Berg«, gelegen irgendwo im oberösterreichischen Salzkammergut. Ein Berg, den sich Robert, der »Schneemänner« errichtende Bildhauer, als Modell nimmt.
Der Autor und der bildende Künstler. Wie sieht bei Ihnen die Aufteilung aus und vor allem: Gibt es vor dem Schreibprozess eine Visualisierung?
Nein, keine Visualisierung, aber während ich schreibe, kritzle ich in einem Heft herum. Eine Art begleitendes Zeichnen, eine graphische Assistenz. Ich notiere Namen und Daten, verfertige kleine Pläne und verbindende Linien, skizziere Tiere, Gesichter und Modelle und schaffe Schmierereien – ich sage dazu auch »Telefonkritzeleien«. Wie man halt früher, als die Telefone noch nicht babygleich durch die Gegend getragen wurden, beim Telefonieren auf Blöcken herumzeichnete. Ziffern und Muster. Mehr abstrakt als gegenständlich. Geradezu meditativ.
Wie können wir uns Ihren Schreibplatz vorstellen? Immer? Überall? Sind Sie Nacht- oder Tagschreiber?
Tagschreiber. Sehr konventionell. Beginnt in der Früh, macht zu Mittag eine Mittagspause, schreibt am Nachmittag weiter und hört am Abend damit auf. Ich bin im Grunde ein Büromensch.
Dazu benötige ich einen Tisch, ordentlich aufgeräumt, sehr ordentlich aufgeräumt, weil ich Unordnung und Fülle um mich herum nicht brauchen kann, dazu ein Fenster mit Blick auf ein Stück Himmel. Das war in den Jahren in Stuttgart trotz großer Wohnung ein eher kleines Stück Himmel, ist in meinem neuen Domizil im südlichen Odenwald trotz kleinerer Wohnung nun ein recht großes Stück. Der Himmel mit seinem Wechsel von Formen und Farben ist ein ziemlich guter Ratgeber in Sachen kreatives Schreiben.
Als begeisterte Steinfest-Leserin folge ich nicht nur mit Genuss den vielen Abzweigungen – oder wie im aktuellen Fall dem Buch im Buch – meine Wahrnehmung teilt mir auch immer wieder mit, dass das ganze ausgefeilte Romangebäude sozusagen um einen bestimmten Kernsatz herum errichtet wurde. Ich möchte es nicht »Botschaft« nennen, aber für mich ist immer ein ganz bestimmter Satz der wichtigste, der mir den gesamten Schreibansatz deutlich macht.
Im aktuellen Roman ist für mich die Frage nach Schuld und Sühne die wichtigste. (Wie geht es Ihnen übrigens mit der Neuübersetzung, wenn Dostojewskis Werk »Verbrechen und Strafe« heißt? Ich finde ja, dass diese Interpretation etwas ganz anderes suggeriert.)
Das mit dem Kernsatz ist eine wirklich interessante Frage. Dabei ist es sicher nicht so, dass beim Beginn des Schreibens ein bestimmter Satz im Raum steht, um den herum die Geschichte aufgebaut wird. Dass dieser Satz dann doch – wenn er einmal gesagt, geschrieben wurde – eine Art geheimen Kern bildet, das mag richtig sein. Ich denke, im »betrunkenen Berg« ist es der Moment, als Robert sich daran erinnert, wie er als Boxer »auf diesen einen Schlag zu viel nicht hatte verzichten können«. Die Frage, warum bloß der Verzicht, der einfache Umstand, etwas Bestimmtes nicht zu tun, so schwierig ist. Und wir all das Unglück in Kauf nehmen, welches diesem einen überflüssigen »Schlag« zu verdanken ist (im wahrsten Sinne ein Nachschlag).
Ich glaube aber auch, dass jede Leserin und jeder Leser seinen eigenen »Kernsatz« im Roman finden kann und darf, dass also mehrere potenzielle Kernsätze existieren. Wie ich ja auch glaube, dass jeder Lesende mittels des Leseprozesses dem Buch eine eigene Form und Farbe verleiht. Es verwandelt.
Und natürlich geht es hier um Schuld und Sühne. Es geht letztlich darum, einen Ausgleich herzustellen. So etwas wie eine Balance zwischen dem Versagen und dem Gelingen. Mir sind die Vokabel »Schuld« und »Sühne« auch lieber als »Verbrechen« und »Strafe«, weil sie tiefer gehen, weniger von Außen herangetragen, als aus der eigenen Empfindung entstanden (wie das übrigens auch in den Vorgängerbüchern »Die Büglerin« und »Der Chauffeur« der Fall war).
Wie groß ist der Spaß, wenn der Autor sich auf seine eigenen Werke rückbezieht – Stichwort Lilli Steinbeck?
Wunderbar. Ich liebe das. Es ist ja nicht etwa geplant, als da plötzlich Lilli Steinbeck in der Geschichte auftaucht. Es geschieht einfach und ich freue mich darüber, wie man sich eben freut, einem alten Bekannten zu begegnen (zumindest dann, wenn der sich zwischenzeitlich nicht zum Ungustl entwickelt hat).
Die Erde buckelt, auch am und im Bücherberg. Sie tut das nicht erst seit gestern, es brennt im Wortsinn und metaphorisch. Wie geht es Ihnen mit der Welt gerade und wie geht es Ihnen mit Ihrem gesellschaftspolitischen Engagement – Stichwort Stuttgart 21?
Ich bin letztlich nur Chronist einer surrealen Wirklichkeit und nicht Aktivist. Ich schaue mir die Welt an und schreibe darüber. Das ist es auch schon. Bei Stuttgart 21 bin ich halt reingerutscht, wie dort viele Bürger reingerutscht sind und war dann eine Weile im Bahnhofsstrudel gefangen (keine uninteressante Erfahrung, wobei es letztlich wenig nutzt, Recht zu haben, aber nicht Recht zu bekommen). So studiere ich die diversen Strudel und versuche deren Ursprünge auszumachen, was letztlich die Form des Kriminalromans in vielerlei Hinsicht erzwingt, ohne dass es sich um definitive Kriminalromane handeln muss. Die ganze Welt ist ein Kriminalroman. Aber seine eigentliche Quelle ist nicht der Wahnsinn im Großen, auch wenn die dramatischen Weltenbrände das suggerieren, sondern im Kleinen, im Persönlichen, im Mikroskopischen unseres Alltags – was wohl der Grund dafür sein dürfte, dass wir noch immer zu den Waffen greifen, wenn die Waffen uns rufen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unterhalten Sie eine eher kleine Bibliothek – wie schaffen Sie das und wie wählen Sie aus, was bleiben darf?
In dieser Sache bin ich gescheitert, wieder einmal. Ich hatte für einige Jahre eine einzige kleine Küchennische, in der ich die mir aktuell wichtigsten Bücher vereint habe, allein diese, kreuz und quer, aber so lückenlos, sodass schließlich nur mehr sehr kleine, dünne Bände hineingepasst haben, etwa die Reclamausgabe von Thomas von Kempens »Das Buch von der Nachfolge Christi«. Aber irgendwann kamen andere Bücher in die Wohnung, Geschenke, Belegexemplare, unvorsichtigerweise Gekauftes, Bücher, die ich nicht rechtzeitig weitergegeben und verschenkt habe und die in irgendwelchen Zimmer- und Flurecken zu Stapeln anwuchsen. Na ja, und schließlich habe ich der Macht nachgegeben und mir doch wieder ein paar Bücherregale zugelegt. Bin aber auch schon mal schlimmer gescheitert.
Welche Bedeutung hat für Sie das Krimi-Genre im Moment? Ich hoffe ja immer noch auf die Rückkehr von Cheng und frage das als passionierte Krimileserin, die sich immer dafür stark zu machen versucht/e, den Krimi aus einer Art Zweitklassenliteratur herauszuholen. Der gute Krimi war immer schon gesellschaftspolitisch.
Und wie geht es Ihnen – nicht nur beim Krimi – mit der Triggerwarnung? Und wenn wir schon dabei sind: Wie stehen Sie zur Diskussion um cultural appropriation?
Ich schreibe gerade an den Schlusskapiteln zu meinem letzten, wirklich allerletzten Cheng-Roman, in dem wieder Frau Wolf seine Chefin ist und er ihr Sekretär, diesmal aber das Augenmerk mehr auf Cheng liegt, meinem sogenannten Serienhelden. Es braucht jetzt mal einen richtigen Abschluss (auch wenn mir das einige nicht glauben werden).
Bezüglich des Genres … meine Güte, mal heißt es »Roman«, mal »Kriminalroman«, das hat für den Markt und freilich auch für die Kritik eine Bedeutung, für mich nicht. Oft weiß ich nicht mal zu Beginn einer neuen Geschichte, ob sie sich mehr in die eine oder andere Richtung bewegen wird. Jedenfalls schreibe ich ganz sicher nicht darum »reine« Romane, um mich auch mal als wahrhaftigen Literaten fühlen zu dürfen.
Das mit der Zweiklassenliteratur ist eigentlich ziemlich kindisch. Wenn ich das so sagen darf, eine deutsche Krankheit. Eine Germanistenkrankheit. Ist aber heilbar. Dauert nur.
Triggerwarnung? Nun, ich sehe Literatur und Film und Kunst als einen Trostspender, in dem Sinn, dass hier die Wirklichkeit der Welt eine kunstvolle Spiegelung erfährt. Und dadurch heilend wirkt, indem sie, die Kunst, eben nichts verdrängt, sondern vielmehr die Dinge zur Sprache bringt. Und sie verwandelt. Dem Schrecken den Stachel nimmt, indem sie ihn beschreibt (den Schrecken wie den Stachel). Das nennt man wohl Therapie. Davor muss man nicht warnen.
Im »betrunkenen Berg« gibt es ja auch ein Buch im Buch, darin drückt es der junge, progressive Priester, der Ende des 19. Jahrhunderts lebt, so aus, »dass das wesentliche Element des Menschen die Krise sei. Die Kunst versuche, dieser Krise eine ›schöne Gestalt‹ zu verleihen und sie mittels der Schönheit erträglich zu machen.«
Diese Schönheit, möchte ich anfügen, schließt ja keineswegs eine direkte Behandlung des Schrecklichen und Horriblen aus. Im Gegenteil. Darum sind mir Adalbert Stifter und H. P. Lovecraft gleichermaßen nahe.
Und ja, dann noch die Frage nach der »kulturellen Aneignung«. Das ist zu vielschichtig für eine einfache Antwort, diese ganze Spannbreite zwischen der Zurückgabe geraubter Kulturgüter und dem Abbruch eines Konzerts Schweizer Musiker, weil sich einige Zuhörer unwohl fühlten angesichts von Schweizern, die Übergebühr Rastas tragen. Persönlich fände ich es wichtiger, dem »angeeigneten Kulturgut« mit jener Würde zu begegnen, die es verdient und nicht zu seiner Banalisierung beizutragen, was ja auch etwa für die heimische Volksmusik gilt, die sich der so viel mächtigere Apparat der Schlagermusik angeeignet und daraus wahrhaftige Scheiße geformt hat. Die freilich gefällt. Mancher Kot kann halt auch verzaubern.
Aber etwa die klassische Moderne wäre ohne den Einfluss afrikanischer und asiatischer Kunst undenkbar, eben weil deren Einfluss half, die festgefahrenen Prinzipen klassischer Formensprache aufzubrechen. Das sollte man erwähnen, aber nicht beklagen.
Und selbstverständlich geht die Beeinflussung auch in die andere Richtung. Mein Gott, würde der Austausch der Errungenschaften der jeweiligen Kulturen nur so gut funktionieren wie in der Kunst, die nun mal eine diebische Freude hat, alles aufzusaugen, was es da so gibt in der großen weiten Welt. Bin ich jetzt naiv oder reaktionär?
(Wobei ich schon noch eine Idee hätte, nämlich ein paar Rembrandts und Schieles dorthin zu schicken, wo es noch keine Rembrandts und Schieles gibt, falls man dort Interesse hat, sich anzusehen, was die Europäer so in den letzten Jahrhunderten zu Wege gebracht haben. Das wäre dann keine Raubkunst, sondern eine Geschenkkunst. Und wenn aus monetären Gründen nötig, kann man die Bilder immer noch zu Sotheby’s oder Christie’s schicken.)
Heinrich Steinfest, 1961 Albury, Australien geboren, wuchs in Wien auf und lebt heute mit seiner Familie in Stuttgart. Bekannt wurde er unter anderem für seinen einarmigen Detektiv Cheng, er wurde mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Steinfest wechselt souverän zwischen den Genres und wurde mit seinen Büchern bereits für den Deutschen und den Österreichischen Buchpreis nominiert. Zuletzt erschien von ihm »Der Chauffeur« (Piper).
—
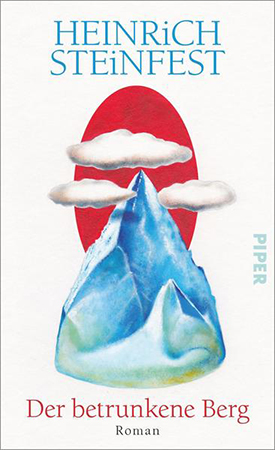
Heinrich Steinfest
Der betrunkene Berg
Piper, 224 S.













