Zu Ilse Aichingers 100. Geburtstag am 1. November stellt sich die Frage, ob der Schriftstellerin und Erzählerin dieser Gedenktag so recht gewesen wäre. Text. Sylvia Treudl, Foto: Stefan Moses.
So sehr sich Anlässe wie runde Geburtstage o.ä. Jubiläen auch anbieten mögen, sich der zu ehrenden Personen zu erinnern, so sehr haben sie oft auch etwas Fragwürdiges – boshaft formuliert könnte man sagen, damit wäre wieder für eine Zeit lang das Gedenken, und im Falle von Autor/innen die Beschäftigung mit ihrem Werk, erledigt. Bei Ilse Aichinger kommt einem unwillkürlich der Terminus des Misstrauens in den Sinn. Sie hat heftig misstraut – auch dem eigenen Schreiben, oder besser: jenen Wörtern, die sie nicht bis zur Kenntlichkeit bearbeitet, den schlampigen Gebrauch, das Allgemeine abgeschliffen hat, bis sie »einsam« waren – und somit erst wieder Bedeutung erlangten.
Der Band »Aufruf zum Mißtrauen. Verstreute Publikationen« ist soeben im S. Fischer Verlag erschienen und vermittelt gerade zum titelgebenden Text eine bemerkenswerte Einlassung der Autorin, die just dieses wesentliche Material, das erstmals 1946 veröffentlicht wurde, ab 1967 für weitere Publikationen sperrte, da ihr der Text »nicht gut genug geschrieben erschien«. Abgesehen von der höchst interessanten Begebenheit um »das Mißtrauen« finden sich in diesem sorgfältig von Andreas Dittrich zusammengestellten Titel ca. 100 kleinere Arbeiten, die Aichinger nicht in ihre Bücher aufgenommen hat, und die bislang nur in Zeitungen und Zeitschriften zu finden waren. Dazu zählen auch Texte aus den frühen 2000er-Jahren, die an Brillanz und/oder Schärfe nichts zu wünschen übrig lassen.
Also: Anlässlich des 100. Geburtstages (1921–2016) dieser bedeutenden, in ihrem Schreibgestus unverkennbaren Autorin sind einige Publikationen entstanden, die mehrheitlich hervorragend dazu angetan sind, sich ihrem Werk anzunähern. Sofern sich Lesende nicht sofort an das puristische Erleben heranwagen und sich dem Ursprungstext aussetzen. Denn ein Aussetzen auch in der Lesehaltung ist es, sobald man einen Aichinger-Text an sich heranlässt. Man gleitet nicht in ein laues Bad gefälliger Narration und richtet sich nicht behaglich »im geschützten Haus der Wörter« ein. Ilse Aichinger dekonstruiert, erschafft gleichzeitig Wortkreationen, produziert Bilder, die surreal sind und oft die Grenze zum Albtraum überschreiten.
Als 26-Jährige beginnt sie »einen Bericht« zu schreiben, der in der Folge 1947 als ihr einziger Roman »Die größere Hoffnung« erscheint.
Die Tochter aus einer jüdischen Familienlinie – und somit als »Mischling ersten Grades« klassifiziert –, übersteht die Faschisten in Wien als U-Boot, versteckt ihre Mutter und bleibt in Wien – im Gegensatz zur Zwillingsschwester Helga, die 1939 mit einem Kindertransport nach England emigriert. Die Erfahrung mit Krieg, Massenvernichtung, die Deportation der geliebten Großmutter machen es der jungen Frau, die sich keineswegs als »Dichterin« sehen will (auch später nicht, als sie längst als Schreibende reüssiert), offensichtlich unmöglich, sich dem Erlebten in einem konventionell erzählenden Duktus zu nähern.
Ihr Schreiben ist ein sich selbst gegenüber gnadenloser Akt der Auseinandersetzung. Was Bert Brecht in seinen Gedichten »An die Nachgeborenen«sowie im »Kinderkreuzzug«unglaublich berührendformuliert, findet bei Ilse Aichinger zu eineranderen, zu einer radikaleren Ausprägung, einem unvergleichlichen Verfremdungseffekt: Eine der eindringlichsten Passagen in ihrem Roman behandelt ein verlorenes Englisch-Vokabelheft: »Ein Kind mußte es verloren haben, Sturm blätterte es auf. Als der erste Tropfen fiel, fiel er auf den roten Strich. Und der rote Strich in der Mitte des Blattes trat über die Ufer. Entsetzt floh der Sinn aus den Worten zu seinen beiden Seiten und rief nach einem Fährmann: Übersetz mich, übersetz mich! (…) Der Strich hatte die Farbe des Blutes. Eher soll der Sinn ertrinken, als daß wir das Blut verraten.« Auch die Kinder in der »größeren Hoffnung« sind so verlassen wie jene bei Brecht, aber sie wählen andere Methoden, um zu versuchen, ihre Leben zu retten.
Ilse Aichinger arbeitet mit der »Widerständigkeit des Wortmaterials«, sie ist interessiert an den Brüchen, den Rissen, zu ihrem Werkzeug zählen Präzision, Geduld, Betrachtung. »Man muss merken, dass ein Satz stimmt, dann muss ebenso der nächste Satz stimmen.« Sorgfältige Konstruktion, ohne ein Konstruieren im Sinne von »Dahererfinden« zu produzieren.
Wer sich mit Aichingers Leben und Werk auseinandersetzen will, sollte sich die Fischer-Werkausgabe aus den frühen 1990ern nicht entgehen lassen, in der auch der schmale, aber höchst bemerkenswerte Ergänzungsband von Richard Reichensperger »Die Bergung der Opfer in der Sprache« Aufmerksamkeit verdient.
Auch unter den aktuellen Neuerscheinungen zu Aichinger finden sich besonders gelungene Titel, die der eingangs erwähnten Ironie zuwiderlaufen: »ununterbrochen mit niemandem reden. Lektüren mit Ilse Aichinger« (S. Fischer), in dem sich Thomas Wild sensibel sowohl auf die Autorin von Prosa, Gedicht, Hörspiel, Szenen, Dialogen, poetologischen Reflexionen, Essays, Zeitungskolumnen und Briefen einlässt – und geübte Leser/innen wie Aichinger-Neulinge in den überwältigenden Sprachkosmos hineinzieht.
Jutta Sauer legt bei Aviva den Band »Wie nur ein Haifisch trösten kann. Ilse Aichinger. Ein Porträt« vor, das Dreigestirn Aichinger/Bachmann/Eich findet sich im Suhrkamp Verlag unter dem Titel »Halten wir einander fest und halten wir alles fest. Briefe« und die wunderbare Edition Korrespondenzen legt mit »Die Frühvollendeten« Radio-Essays vor – eine Publikation, die ganz und gar der Liebe Ilse Aichingers zum gesprochenen Wort entspricht – dem Hörspiel hat sie jederzeit den Vorzug vor dem TV eingeräumt.
Besonders interessant und polyphon: Das »Ilse Aichinger Wörterbuch«, herausgegeben von Birgit Erdle und Annegret Pelz bei Wallstein: Dieser Band versammelt nach dem Alphabet geordnete Essays. Die Herausgeberinnen merken dazu an: »Der Essay, der nicht erfindet, sondern nur neu ordnet, setzt die Lesenden auf die Fährte einer Suche und weist ein Verstehen zurück, das ›nichts als das Herausschälen dessen [ist], was der Autor jeweils habe sagen wollen.‹ Gerade ›im Stückhaften‹, im ›Akzentuieren des Partiellen gegenüber der Totale‹ ist der Essay als Form geeignet, mit dem Textverfahren Aichingers in Dialog zu treten. Er vermeidet das vorschnelle Bilden und Akzeptieren von Zusammenhängen, ›wie es die Wissenschaft tut, [denn damit, so Aichinger] kommt man nicht weit.‹ ( … ) Nicht auf Vollständigkeit ist es aus; die über siebzig Einträge wollen mit ihrer offenen Textur zur Erforschung und zur Lektüre von Aichingers Werk anregen.«
Es gibt zu der Filmliebhaberin, Kaffeehausbesucherin, streitbaren Kolumnistin, Gruppe 47-Assoziiierten, Vazierenden, Ablehnerin großer Preise, heftigen Kritikerin des Literaturbetriebs und seiner hoffärtigen Betrieblichkeit, England-Liebhaberin, zu der ganz und gar »Altersunmilden« noch sehr viel zu entdecken; für jene, die sich in Politik und Medienbranche großtun, müsste sie Pflichtlektüre sein. Wer durchfällt beim Aichinger-Test, sollte den Job umgehend quittieren.
Anm.: Als vehemente Gegnerin der Rechtschreibreform hat I.A. verfügt, dass ihre Texte nicht auf neue RS umgestellt werden dürfen.



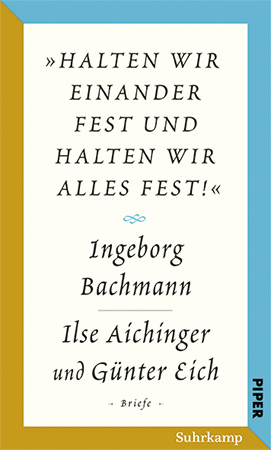

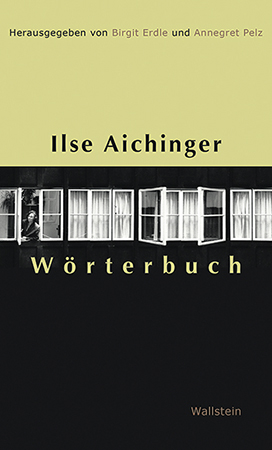
BB – Berichte und Zeugnisse
—
Ilse Aichinger
Aufruf zum Mißtrauen. Vertreute Publikationen 1946–2005
S. Fischer, 320 S.
Thomas Wild
ununterbrochen mit niemandem reden. Lektüren mit Ilse Aichinger
S. Fischer, 368 S.
Jutta Sauer
Wie nur ein Haifisch trösten kann. Ilse Aichinger. Ein Porträt
Aviva, 200 S.
Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Günther Eich
Halten wir einander fest und halten wir alles fest. Briefe
Suhrkamp/Piper, 347 S.
Ilse Aichinger
Die Frühvollendeten
Edition Korrespondenzen, 180 S.
Birgit Erdle und Annegret Pelz (Hg.)
Ilse Aichinger Wörterbuch
Wallstein, 368 S.

Genauso, wie es war
llse Aichinger ist nicht nur eine der renommiertesten Autorinnen der Gegenwart, sie ist auch eine stetige Kämpferin gegen das Vergessen und Vertuschen der Vergangenheit. 1996 wurde sie 75 – Petra Rainer traf sich mit ihr für Buchkultur Ausgabe 43 zu einem Gespräch.
Buchkultur: »Die größere Hoffnung« war Ihre erste große Publikation; was bedeutet sie heute für Sie?
llse Aichinger: Ein Beginn, von dem ich nicht wußte, daß es ein Beginn war. Ich hatte nicht den Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Ich habe Medizin studiert, das ist daran gescheitert, daß ich manuell zu ungeschickt war, ich hab alles durchschnitten, schon in der Anatomie.
Im Krieg war ich dienstverpflichtet, konnte aber in Wien bleiben, in einer Buchhaltungszentrale für Apotheker. Der Prokurist sagte öfter: ,»Sie machen etwas anderes, ich komme nicht drauf, was Sie machen, Buchhaltung machen Sie ziemlich wenig, da ist eh besser (lacht) Sie machen etwas anderes.« So habe ich zu schreiben begonnen. Ich wollte eigentlich nur einen Bericht schreiben, auf Zettel in dieser Apothekenbuchstelle habe ich das geschrieben, meistens in Blockschrift. Bis heute schreibe ich Prosa lieber auf der Maschine, es stellt sich mir da besser dar, ob die Sätze stimmen oder nicht. Auf die ldee, einen Roman zu schreiben und Schriftstellerin zu werden, bin ich nicht gekommen. Im Gegenteil, ich wollte Ärztin werden, meine Mutter war auch Ärztin, aber sie war manuell geschickter als ich.
Als erstes fiel mir der erste Satz vom letzten Kapitel ein, sowohl der Name als auch das letzte Kapitel, und ich wußte auch nicht, was das sollte. Klar war nur, daß ich berichten wollte, was ich erlebt habe. – Meine Mutter hatte nach dem Krieg eine Stellung in einem Heim für Sterbende angenommen, die ärztliche Behandlung brauchten – die Spitäler hatten diese Sterbenden entlassen, um ihre Statistiken nicht zu verschlechtern. Man war umgeben von total Schwerhörigen, Röchelnden, und wir hatten ein Zimmer dort und dort konnte ich gut arbeiten. Kurklinik »Herbstsonne« hat es geheißen. »Die größere Hoffnung« ist dort entstanden und dann endlich erschienen, und in den ersten drei Jahren sind fünf Stück verkauft worden.
In der »größeren Hoffnung« drückt sich eine gewisse Lebenshaltung aus, nämlich dieses Ausgerichtetsein auf die größere Hoffnung …
Inzwischen bin ich etwas anarchischer eher geworden, in meiner Grundhaltung, auch in meiner Sprache. Ich glaube an die Existenz von Menschen, gleichgültig, ob sie leben oder gestorben sind, es gibt sehr viele Lebende, die gar nicht existent sind. Und andere sind existent, auch wenn sie schon tot sind. Zum Beispiel meine Großmutter, die ein unvorstellbares Schicksal hatte, eigentlich war sie prädestiniert für diese Schicksal. Sie wollte immer teilen und hergeben und war der geduldigste Mensch den ich kannte und mir der liebste Mensch auf der Welt und sie hat für mich bis heute die größte Präsenz.
Ist diese bleibende Existenz die größere Hoffnung?
Vielleicht. Ich erinnere mich, wir waren als Kinder, wir waren identische Zwillinge, das ist sehr schwer für eine Mutter die zur Arbeit muß, wir haben wahnsinnig gerauft, und wenn meine Großmutter da war und meine Mutter zu schimpfen begonnen hat, hat meine Großmutter gesagt, ich hör sie noch sagen: »Lob sie, lob sie, das ist das Beste.« Eben diese Präsenz hat sie vermutlich das Leben gekostet.
»Die größere Hoffnung« berichtet von etwas, das war. Sind Ihre späteren Texte fiktiver?
Eigentlich ist alles, was ich geschrieben habe, in den Sätzen entstanden. Es ist mir ein Satz eingefallen und ich wußte, daß der Satz stimmt. Es ist schwer, daß man beim Schreiben keine Vorlage hat. Wie mein Mann einmal geschrieben hat – man müßte aus dem Urtext übersetzen. Ich würde viel lieber übersetzen. Da liegt links etwas, an das man sich halten kann, und es kann eine Freude sein, es herüber zu bringen. Wenn aber links gar nichts liege, da kommt man sich wie ein Fabeldichter vor. Ich habe das Wort »Phantasie« immer gehaßt, ich wollte mit der Sprache immer nur genau sein. Genau so, wie es war. Es war so – und es war nicht so.
Mir ist aufgefallen, daß sich Ihre Texte förmlich an bestimmten Orten entzünden.
Ja, das ist sehr gut gesagt! Vieles ist topographisch. Zuerst die Topographie von Wien, später die von London: 1948 sind wir – meine Mutter und ich waren nach langen Bewilligungsverfahren zum ersten Mal nach England gefahren, um meine Schwester und Tante zu besuchen, die dorthin emigriert waren – an einem roten Ziegelblock vorbeigekommen, da sagt meine Schwester, daß das ein Spital ist, und hier sei die Ruth Fürst gestorben. Die »Spiegelgeschichte«, die war eigentlich diese rote Gebäude. Wenn ich das nicht gesehen hätte, hätte ich es auch nicht geschrieben. lch bin abhängig von Orten und Gegenden. – Sehr wichtig war mir die Gegend im dritten Bezirk, wo meine Großmutter gewohnt hat. Da steht auch das Palais Metternich, der soll gesagt haben: hundert Meter von meinem Haus entfernt beginnt Asien. Wir haben schon in Asien gewohnt, haben aber aus dem sogenannten Salonfenster, der Salon war ungeheizt, man konnte nur im Sommer dort hinausschauen, nach Europa geschaut. Später, nach Kriegsbeginn, haben wir neben der Gestapo gewohnt. Die Gestapo hat damals die Leute bei Tag aus dem Haus geholt. In Berlin hat man sie bei Nacht geholt, was in Wien gar nicht nötig war, jemandem diesen Anblick zu ersparen.
Aber niemand hat etwas gesehen!
Das war ganz leicht zu sehen. Es war alles darauf angelegt, gesehen zu werden. Meine Großmutter wurde mit vielen anderen in einem Viehwagen über die Schwedenbrücke gefahren. Als ich nach ihr rief, wichen die neugierigen Zuschauer zurück. Möglicherweise hatten sie Angst, die Lust an diesem Anblick könnte ihnen vergehen. (Schweigen)
Entstehen Ihre Texte im Kopf oder feilen Sie sie zurecht?
Der wesentlichste Teil des Schreibens ist für mich, nicht zu schreiben, sich auch möglichst gar nicht damit zu befassen, einfach davon wegzubleiben. Das ist aber schwierig, denn was macht man, wenn einer fragt: Was machen Sie gerade? – Ich schreibe gerade nicht. Das ist ja eine unverständliche Antwort. Und es ist auch nicht so, daß man sagt, man wartet darauf. Das schon gar nicht. Ich warte auf gar nichts. Es ist der viel mühsamere Prozeß, nicht zu schreiben. Wenn es sein muß, werden die Sätze plötzlich da sein, wenn es nicht sein muß, werden sie nicht da sein. Aber ich will das nicht erzwingen.
Ist das Nicht-Schreiben eine Art halbe Aufmerksamkeit für die Möglichkeit zu schreiben?
Bei mir war es so. Es gibt natürlich sehr berühmte Autoren, Thomas Mann war so, von denen man weiß, daß sie regelmäßige Arbeitszeiten hatten. Ich hatte Kinder, eine Familie, und ich war abgelenkt, zum Glück. Ich finde es ziemlich unerträglich, nur diesen Beruf zu haben. Noch ein Beruf dazu ist wichtig, ob Installateur oder was man eben kann. Heute finde ich wichtig, daß man nicht einfach drauflosschreibt, ohne zuvor auch andere Milieus gesehen zu haben und ohne Leiden zu erfahren. Ob in Spitälern, Altersheimen, irgendwelchen Kinderheimen. Es gibt genug Elend.
Was bedeutet die Farbe Grün für Sie?
Nichts. Es kommt bei mir nur verhältnismäßig oft vor.
Haben Sie eine Lieblingsautorin, einen Lieblingsautor?
Joseph Conrad, Georg Trakl. Aber es sind nicht die einzigen.
Was lesen Sie gerade?
Joseph Conrad zum Beispiel, aber auch Elfriede Jelinek, Ruch Klüger und Josef Winkler.
Danke für das Gespräch.
Literaturtips:
Ilse Aichinger:
Die größere Hoffnung
Roman. S. Fischer Verlag 1995. 248 S., DM-sFr 24/öS 175
Gesammelte Werkte
Bd. 1. Fischer TB, DM-sFr 14,90/öS 109
Gesammelte Werkte
Bd. 2. Die Gefesselte. Erzählungen 1848-1952.
Fischer TB, DM 10,90/öS 80/sFr 11,90
Gesammelte Werkte
Bd. 3. Eliza, Eliza. Erzählungen 1958-1968.
Fischer TB, DM 10 ,80/öS 79/sFr 1 1 ,80













