Joël Dicker über »Die Affäre Alaska Sanders«, seinen Werdegang und seine nächste große Herausforderung. Foto: Anoush Abrar, Bearbeitung: GM.
Er schreibt nicht nur über grotesk erfolgreiche Literaturphänomene, er ist selbst eines. 2012 ereilte den 1985 geborenen Genfer Joël Dicker mit gerade einmal 27 Jahren ein Erfolg, mit dem er selbst nicht gerechnet hatte. »Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert«, ein 700-seitiger Pageturner über zwei amerikanische Schriftsteller und einen Jahrzehnte zurückliegenden Mordfall wurde nicht nur ein Bestseller, sondern gewann mehrere Preise und landete unter anderem auf der Shortlist für den Prix Goncourt.
Mehrere Krimiwälzer und zehn Jahre später kommt nun die Fortsetzung »Die Affäre Alaska Sanders« heraus, in der nicht nur der Ich-Erzähler Marcus Goldman wieder vorkommt – und dank eines Romans mit dem Titel »Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert« weltberühmt ist –, sondern auch dessen einstiger Mentor Harry Quebert. Goldman stößt wieder einmal auf einen mysteriösen alten Mordfall, der die Karriere seines Polizistenfreundes Perry Gahalowood prägte.
Doch ist es keineswegs so, als wolle Dicker seinen Krimihelden ausschlachten. Er will ja nicht einmal Krimis schreiben. Und das sind nicht die einzigen überraschenden Erkenntnisse aus dem Interview, für das Buchkultur den Schriftsteller per Videoschaltung in seinem Arbeitszimmer in Genf erreichte.
—
Buchkultur: Herr Dicker, während Ihres Jusstudiums haben Sie jedes Jahr ein Buch geschrieben. Jetzt, wo Sie so erfolgreich sind, wäre es da nicht Zeit für eine Veröffentlichung?
Joël Dicker: Diese Bücher waren die perfekte Übung. Wenn ein junger Mann Maler werden will, geht er auf die Kunstschule, wenn er Arzt werden will, studiert er Medizin. Sogar für Fußballtrainer gibt es Ausbildungen. Zinedine Zidane war ein toller Spieler und hat ein paar Wochen einen Kurs besucht, jetzt hat er ein Diplom als Trainer. Aber wenn man ein Autor werden will, gibt es Creative Writing in den USA, aber im französischsprachigen Raum kann man höchstens Literaturwissenschaft studieren. Es gibt keinen, der einem die Werkzeuge an die Hand gibt. Meine ersten sechs Bücher waren sehr wichtig für mich, um schreiben zu lernen. Unter anderem haben sie mir geholfen zu verstehen, warum ich unbedingt Geschichten schreiben wollte.
Und zwar warum?
Weil ich gerne fiktive Geschichten lese. Meine erste Bücher drehen sich um Persönliches, um mich. Es ist normal für einen Anfänger, mit dem zu arbeiten, was naheliegt. Nur las ich sowas überhaupt nicht gerne. Lieber mochte ich großartige Geschichten, die mich aus meiner Wirklichkeit in eine andere Welt katapultieren, wie »Die Schatzinsel« von Stevenson. Diese sechs ersten Bücher zeigten mir also, dass ich Geschichten schreiben wollte, die zu hundert Prozent erfunden sind.
Also keine Annie Ernaux für Sie?
(lacht) Nein, keine Annie Ernaux!
Kurz nach dem großen Erfolg von »Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert« haben Sie einer Interviewerin gestanden, dass Sie das Buch immer weniger mögen. Wie sieht das zehn Jahre später aus, da Sie gerade wieder eine Fortsetzung herausgebracht haben?
Wenn man Erfolg mit einem eigenen Werk hat, versucht man sich davon weitestmöglich zu distanzieren. Als Künstler will man etwas Neues schaffen, das ist das Spannende. Deshalb interessiert es mich auch nicht, meine fünfzehn Jahre alten Texte zu veröffentlichen. Heute sehe ich das etwas anders. Zehn Jahre sind vergangen, ich bin erwachsen geworden. Ich habe geheiratet, Kinder, bin ein anderer Mensch. Heute empfinde ich sehr zarte Gefühle für dieses Buch und den verrückten Trubel, den es ausgelöst hat. Denn es ist gut für mich ausgegangen, ich habe überlebt.
»Die Affäre Alaska Sanders« ist nicht die erste Fortsetzung von »Harry Quebert«, 2016 kam »Die Geschichte der Baltimores« heraus, mit demselben Ich-Erzähler, dem Schriftsteller Marcus Goldman. »Sanders« schließt nun die Lücke in der erzählten Zeit. Haben Sie eher Quebert vermisst oder Goldman?
Die Antwort ist nicht so einfach. Als ich »Harry Quebert« schrieb, hatte ich eine Trilogie im Sinn. Es war ein Projekt, nur für mich. Ich konnte nicht ahnen, dass es so ein Erfolg werden würde. Als der Erfolg kam, wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Alle Augen waren auf mir. Was sollte ich jetzt schreiben? Sollte ich meinem Instinkt folgen und die Trilogie fortsetzen? Also beschloss ich, zunächst nur den geplanten dritten Teil umzusetzen: »Quebert« spielt 2008/09, »Die Geschichte der Baltimores« im Jahr 2012. Ich ließ also eine Lücke für den Fall, dass ich die Trilogie noch vollenden möchte.
Und das wollten sie dann zehn Jahre später?
Im Lockdown kam ich zu dem Schluss, ich müsse dem Jüngling, der ich vor zehn Jahren war, treu bleiben und es zumindest versuchen. Dieses »Buch zwei« war ein Schritt, den ich machen musste, um etwas ganz anderes machen zu können. Ich gab mir ein paar Wochen. Wenn ich nicht so recht in die Gänge kam, würde ich aufhören. Ich holte also die Charaktere wieder hervor, die gewissermaßen meine Freunde geworden waren. Dieser Flair von Neuengland war sofort wieder da! Es hat großen Spaß gemacht, das ist das Wichtigste. Außerdem war es eine Herausforderung, weil Anfang und Ende vorgegeben waren. Die Krimihandlung ist neu – schließlich musste es möglich sein, die Bücher unabhängig voneinander zu lesen –, aber das Buch musste nach der Veröffentlichung des Buches über die »Affäre Harry Quebert« beginnen, und am Ende musste ich Marcus Goldman irgendwie nach Florida schaffen, wo »Die Geschichte der Baltimores« einsetzt.
Sie haben »Die Affäre Alaska Sanders« also auch geschrieben, um Marcus Goldman hinter sich lassen zu können?
Wer weiß, vielleicht wache ich in zehn Jahren auf und schreibe ein viertes Marcus-Buch. Aber zunächst wollte ich dem Bauchgefühl des erfolglosen Autors von damals folgen, der sich eine Trilogie vorgenommen hatte. Wir tun so viele Dinge für den Blick der anderen, wenn wir unsere Fotos mit Filtern auf Instagram stellen. Es ist so wichtig, sein Leben für sich selbst zu leben. Manchen trägt das Bauchgefühl auf, den Job hinzuschmeißen und sich in die Sonne zu legen. Es kann aber auch sagen, dass man sich herausfordern soll.
Jetzt bin ich aber schon überrascht. Denn, ohne zu viel zu verraten: Am Ende der »Affäre Alaska Sanders« fährt Perry Gahalowood davon und hinterlässt Goldman die Akte zu einem ungelösten alten Mordfall. Das habe ich als Teaser für das nächste Buch verstanden.
Das hat einen ganz einfachen Grund: Ich musste Gahalowood loswerden, weil er nicht in den »Baltimores« vorkommt. Aktuell habe ich keinerlei Absicht, dieses vierte Buch zu schreiben.
Gahalowood, Quebert, in ihrem vorigen Buch »Das Geheimnis von Zimmer 622« Macaire Ebezner: Sie stehen auf unaussprechliche Namen, oder?
Schauen Sie, normalerweise, wenn ein Baby geboren wird, haben sich die Eltern vorher auf einen Namen geeinigt. Wenn es möglich wäre, damit zehn Jahre zu warten, könnte man den Namen an die Persönlichkeit anpassen. Das ist der große Vorteil, wenn man ein Buch schreibt! Da kann man zuerst den Charakter entwickeln und ihn dann taufen. Deshalb gebe ich den Figuren beim Schreiben meistens irgendwelche faden Namen wie John und ersetze sie am Ende durch solche, die den Charakter widerspiegeln. Gahalowood ist ein schwer zugänglicher Typ, aber wenn man ihn mal geknackt hat, läuft es einfach. So ist das auch mit seinem Namen. Und Macaire Ebezner klingt, als würde man die Stiegen runterfallen. Nochmals: Es muss Spaß machen!
Ihnen mehr als der Leserschaft?
Man kann Erfolg sowieso nicht planen. »Das Geheimnis von Zimmer 622« erschien im März 2020. Niemand hätte vorhersagen können, dass kurz darauf die Welt stillstehen würde. Nichts ist garantiert. Garantiert ist nur der Genuss, den ich beim Schreiben der Geschichte hatte, den kann mir niemand nehmen. Natürlich hoffe ich immer, dass die Kritik und die Leser/innen ein Buch mögen. Aber es liegt sowieso nicht in meinen Händen.
Bereitet Ihnen das Strukturieren der komplexen Geheimnisse auch so viel Spaß?
Das mache ich nicht. Auch hier: Ich habe keinen Plan, keinen Plot. Es gefällt mir, nicht zu wissen, was in meiner Geschichte passieren wird. Als Leser geht es mir ja auch so: Wenn ich ein Buch lese, bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Warum sollte ich mir diese Freude nehmen, nur weil ich der Autor bin? »Zimmer 622« habe ich unter den gleichen Voraussetzungen begonnen wie Sie als Leser. Es ist frühmorgens, der Zimmerservice betritt eine Suite, da liegt eine Leiche. Wer ist tot? Keine Ahnung! Ich habe ja noch nicht einmal Charaktere entwickelt. Also gehe ich ein paar Wochen in der Zeit zurück und begegne den ersten Figuren. Und ich denke mir: Wer von denen wird wohl ermordet? Und wer wird der Täter sein? Es muss jemand sein, den wir kennen. Ah, der kann es nicht sein, der ist zu nett. Und so weiter. Natürlich überarbeite ich die Geschichte am Ende dann noch einmal.
Sie hatten also auch lange keine Ahnung, wer Alaska Sanders ermordet hat?
Nicht die geringste. Das Einzige, was ich wusste, war: Marcus kommt vor, Perry Gahalowood kommt vor, und am Ende wird Marcus in Florida sein.
Es könnte sein, dass ich einen Fehler in »Zimmer 622« entdeckt habe … (Über die Details sei hier natürlich Stillschweigen gewahrt.)
Großartig, ich schreibe mir das gleich auf. Sowas gefällt mir. Wissen Sie, die Leute geben mir das vermeintliche Kompliment, dass ich meine Leser/innen so gut manipuliere. Aber, wie Sie gerade bewiesen haben, ist das keine Einbahnstraße. Das bin nicht ich allein, es ist ein Spiel zwischen mir und Ihnen, dem Leser. Klar, ich habe den Plot konstruiert und die Worte aufgeschrieben, aber Sie haben freundlicherweise einen kleinen Teil Ihres Hirns dafür verwendet, die Charaktere im Kopf zu behalten. Die sind jetzt für immer Teil ihrer persönlichen Bibliothek. Und wenn Sie dann auch einen Fehler finden, heißt das, Sie spielen das Spiel mit. Wissen Sie, deshalb kann Lesen mehr als Fernsehen: weil Sie sich dabei selbst eine Welt bauen. Es ist Ihre Geschichte!
Zurück zu »Alaska Sanders«. Wie kommt es, dass Sie sich so gut an der amerikanischen Ostküste auskennen?
Ich habe Cousins in den USA. Sie leben in Washington D.C. und haben ein Sommerhaus in Maine. Seit ich vier Jahre alt war, habe ich dort die Sommer meiner Jugend verbracht. Es fiel mir schwer, eine fiktive Geschichte in meiner eigenen Realität anzusiedeln, also in Genf. Die Gegend von Neuengland kannte ich wie mein Zuhause, dennoch bestand eine gewisse Distanz.
Haben Sie diese Hemmungen inzwischen überwunden? »Das Geheimnis von Zimmer 622« spielt ja in Genf und Verbier.
Das war eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Meine Herausforderung für dieses Buch, bevor ich noch irgendeine Ahnung hatte, was darin vorkommen würde, bestand darin, eine komplett fiktive Geschichte in der Schweiz anzusiedeln.
Steht am Beginn jedes Buches eine solche Aufgabe? Ist das Teil des Spiels?
Ja, ein Spiel, aber ich möchte auch jedes Mal ein bisschen besser werden. Das ist so, wie ich einmal die Woche laufen gehe, immer dieselbe Strecke. Und wenn ich ein paar Sekunden schneller bin als beim letzten Mal, dann freue ich mich. Es fühlt sich einfach gut an.
Worin besteht die nächste Challenge?
Ein kürzeres Buch zu schreiben. Meine Lieblingsbücher sind »Farm der Tiere«, »Von Mäusen und Menschen«, »Der alte Mann und das Meer«, lauter sehr kurze, aber auch dichte Geschichten: Da steckt alles drin.
Sie haben zuvor Robert Louis Stevenson als Vorbild erwähnt, jetzt auch noch Orwell, Steinbeck, Hemingway. Das sind alles keine Krimiautoren.
Tatsächlich nehme ich meine eigenen Bücher auch nicht als Krimis wahr. Es gibt zwar Morde und Ermittlungen, die wesentlich zur Spannung beitragen, aber meine Bücher sind nicht um die Verbrechen herum aufgebaut, sondern um die Charaktere. Die Krimihandlung ist nur ein praktisches Werkzeug, um all diese Menschen zusammenzubringen. Entscheidend an »Die Affäre Alaska Sanders« ist für mich diese junge Frau Alaska mit ihrem Kampf um Selbstständigkeit, ist die Beziehung zwischen Marcus und Perry, zwischen Perry und Helen. Das alles würde auch ohne den Mord funktionieren, das Buch wäre nur etwas kürzer.
Sie lesen selbst also gar keine Krimis?
Erst in letzter Zeit entdecke ich Agatha Christie und Arthur Conan Doyle. Und was ich daran liebe, ist das Drumherum, die Atmosphäre. Ich liebe die Beschreibungen des nebligen London oder der kleinen Cottages am Land, oder wie Sherlock Holmes nur mit einem Blick auf die Art, wie er seine Fliege gebunden hat, alles über seinen Besucher weiß. Darin zeigt sich die Kraft der Literatur, den Leser aus seinem Leben in ein anderes Leben zu verfrachten.
Vor kurzem haben Sie Ihren eigenen Verlag gegründet. Wie kam es dazu?
Mein Verleger war ein großartiger Mann namens Bernard de Fallois, der auch in »Zimmer 622« vorkommt. Er starb vor fünf Jahren und hatte testamentarisch verfügt, dass sein Verlag nach seinem Tod schließen solle. Er wollte verhindern, dass ein großer Konzern ihn übernahm und er seine Seele verlor. Was sollte ich nun tun? Zu einem anderen Verlag zu gehen, hätte ich als Verrat an Bernard empfunden. Also habe ich meinen eigenen Verlag gegründet, nur für mich, wie Bernard damals.
Veröffentlichen Sie dort nur Ihre eigenen Bücher?
Auch solche, die ich mit der Welt teilen möchte. Im August bringen wir zum Beispiel ein fantastisches Sachbuch von der amerikanischen Autorin Maryanne Wolf heraus, das übrigens auf Deutsch bereits vorliegt. Der Originaltitel ist »Reader, Come Home«. Es geht darum, wie das Hirn arbeitet, wenn wir lesen.
Auf Deutsch heißt es: »Das lesende Gehirn: Wie der Mensch zum Lesen kam – und was es in unseren Köpfen bewirkt«.
Es verrät uns, warum wir lesen müssen. Wir, die wir ohnehin gerne lesen, versuchen andere immer, davon zu überzeugen, aber es ist schwer, Argumente zu finden. Sie erklärt das wissenschaftlich. Die Gründe sind die gleichen, aus denen wir täglich zehntausend Schritte gehen, aber lieber nicht fünf Liter Cola trinken sollten. Wir tun, was uns guttut. Lesen tut gut.
Ist das das erste Buch in Ihrem Verlag, das nicht von Ihnen stammt?
Absolut. Ich möchte das auch klein halten. So kann ich weiter dahinterstehen und mir Zeit nehmen, meiner Leserschaft zu erklären, warum mir diese Bücher wichtig sind. Wir ertrinken geradezu in den neuen Büchern, die jedes Jahr auf Französisch herauskommen. Auch die Journalist/innen verlieren da den Überblick. Mir geht es mit meinem Verlag eben nicht darum, zu dieser Masse noch mehr hinzuzufügen. Wenn mir pro Jahr drei Bücher besonders wichtig erscheinen, dann sind publiziere ich eben drei. Vielleicht sind es im nächsten Jahr null.
Aus diesem Interview geht erfreulicherweise hervor, dass Ihr Leben in keiner Weise dem der Schriftsteller in Ihrem Buch ähnelt: Sie sind nicht reich, aber einsam, erfolgreich, aber traurig. Dennoch scheinen Ihre Texte diesen Eindruck erwecken zu wollen – Marcus Goldman hat ein Buch mit dem Titel »Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert« geschrieben, und der Ich-Erzähler in »Zimmer 622« heißt Joël und trauert um den Verleger Bernard de Fallois. Wieso diese Parallelen?
Die Antwort beginnt wie so oft mit »Harry Quebert«, dem ersten meiner Bücher, das nicht das Geringste mit mir zu tun hatte. Da der Erzähler Marcus Goldman ein Schriftsteller ist, gingen viele davon aus, das sei ich. »Aber wieso?«, rief ich, »Da steht ›Roman‹ am Buchdeckel und mein Name, der Joël lautet und nicht Marcus.« Sie ließen mir keine Ruhe, und als das Buch als Serie verfilmt wurde, monierten sie, dass mir der Hauptdarsteller ja gar nicht ähnlich sehe. Also wollte ich in meinem Genfer Buch mit meinen Leser/innen spielen und nannte meinen Ich-Erzähler, auch einen Autor, Joël. Und interessanterweise sind Sie einer der Ersten, die mich darauf ansprechen.
Sie haben also gar keine Sekretärin?
(lacht) Korrekt. Ich habe keine Sekretärin.
Joël Dicker wurde 1985 in Genf geboren. Seine Bücher »Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert« und »Die Geschichte der Baltimores« wurden weltweite Bestseller und über sechs Millionen Mal verkauft. Für »Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert« erhielt Dicker den Grand Prix du Roman der Académie Française sowie den Prix Goncourt des Lycéens.
—
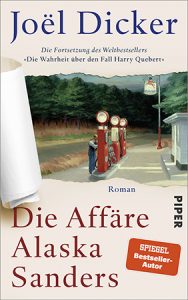
Joël Dicker
Die Affäre Alaska Sanders
Ü: Michaela Messner, Amelie Thoma
Piper, 592 S.













