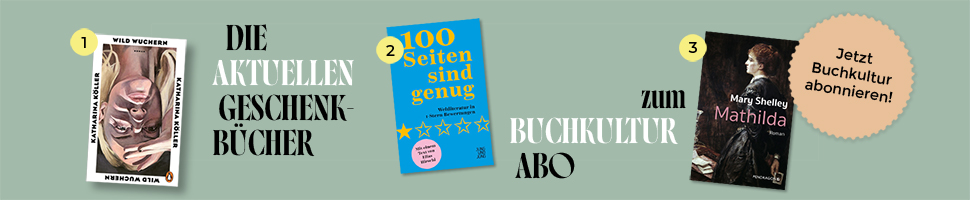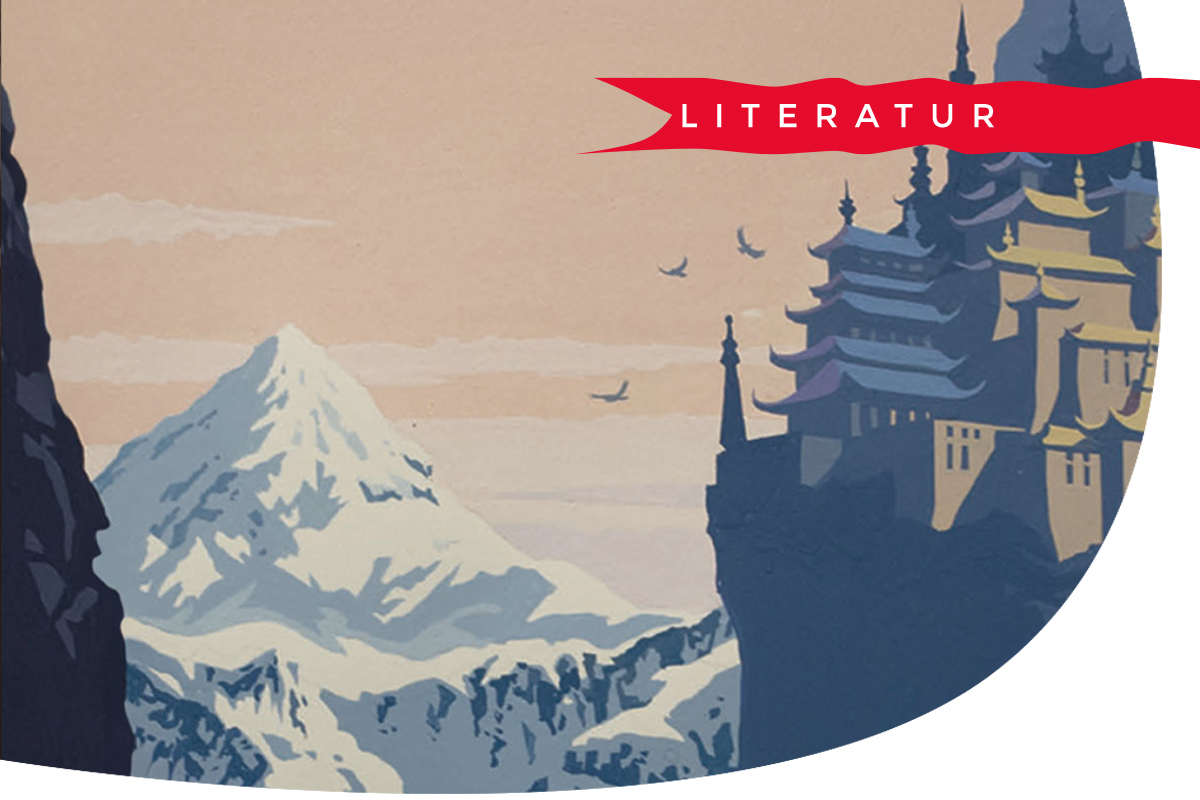Vom Aberglauben, der Berge versetzt, und vom Schicksal-Spielen für Abergläubige. Foto: Paula Winkler.
Die Protagonistin in Katja Kullmanns neuem Roman »Stars« setzt alles auf eine Karte – und wechselt vom langweiligen Bürojob ins Astrobusiness. Die Schriftstellerin im Buchkultur-Interview anlässlich der Titelstory von Ausgabe 219 über das scheinbare Paradox, als rationaler Mensch ein Horoskop zu befragen, warum wir den Sternen so gern Glauben schenken und was das alles mit der Weltlage zu tun hat.
—
Buchkultur: Bisher als Journalistin, Essayistin und Sachbuchautorin in Erscheinung getreten, haben Sie nun mit »Stars« Ihren ersten Roman geschrieben. Wann kamen Sie zur Geschichte und was hat Sie dabei gefesselt? War es das Thema Astrologie oder war es die Protagonistin Carla Mittmann, die zuerst da war?
Katja Kullmann: Oh, gleich zu Anfang mal, was mir wichtig ist: Ich habe schon öfter Fiktionales geschrieben, eine Novelle von 180 Seiten, Kurzgeschichten, Rollenprosa. Aber im deutschsprachigen Raum nagelt man Autor/innen gern fest: Die hat erfolgreiche Essays veröffentlicht – so speichern wir die jetzt ab. In Frankreich oder den USA erlaubt man Schreibenden viel eher, zwischen den Formen zu springen, und so habe ich es jetzt auch wieder gemacht: Bei all meinen Büchern habe ich immer zuerst ein Thema, eine Szene oder eine Figur im Kopf, einen bestimmten Typus ›Gegenwartsmensch‹ – dann überlege ich, wie ich am besten darüber schreiben kann. Hier hat mich nun fasziniert, wie viele Menschen sich inzwischen mit Astrologie beschäftigen, auch Leute, die sich sonst gern als ›Vernunftmenschen‹ ausgeben. Ich fragte mich, wie das geht: sich einerseits für ungeheuer rational zu halten, andererseits aber doch heimlich eine Horoskop-App auf dem Handy zu haben. Mit einem Roman komme ich näher an diesen Widerspruch heran, fand ich.
»Der Gedanke, dass bestimmte Dinge vielleicht doch ein bisschen vorbestimmt sind, kann sehr tröstlich sein.«
Würden Sie gerne an Astrologie glauben?
Ja, manchmal schon. Weil es natürlich etwas Entlastendes hat. Die Welt scheint immer komplizierter zu werden, und je schärfer der Wind weht, auch im kapitalistischen Wettbewerb, desto stärker der Druck auf die Einzelnen: Checkst du überhaupt noch, was läuft? Kannst du dich behaupten? Hast du deine Potenziale voll ausgeschöpft? Wir sehen ja, wie viele Menschen sich mittlerweile für »Mental Health« interessieren, Therapien machen, denken, dass mit ihnen und ihren Gefühlen etwas nicht stimmt. Der Gedanke, dass bestimmte Dinge vielleicht doch ein bisschen vorbestimmt sind, kann da sehr tröstlich sein – als ob irgendwo ›ganz oben‹ jemand ein bisschen auf einen aufpasst. Oder als ob es doch eine Art Script gäbe, noch ein ganz anderes Drehbuch fürs eigene Leben, noch mehr Chancen, noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten, die der Kosmos für einen parat hat und die man bloß noch entdecken muss …
Privat wie politisch unsichere Zeiten machen es wahrscheinlicher, dass Menschen der Verführung des Astrobusinesses verfallen. Vermutlich ist jene Grenze, ab der das nicht mehr gesund ist, der Moment, in dem ihnen das mehr schadet als wohltut. Wo aber liegen diese Vorteile, wo liegt der Schaden? In der Realität wie auch im Buch?
Als junge Erwachsene hatte ich selbst mal eine Phase, in der ich mich stark für die Astrologie interessiert habe. Ich habe das damals sogar alles richtig gelernt, die Zeichen, die Häuser, die Aspekte. Es waren immer persönliche Umbruchphasen, in denen ich auf ›die Sterne‹ zurückgriff, eine gescheiterte Liebesbeziehung, ein größerer Umzug. Aus meinem Horoskop habe ich in solchen Krisenmomenten versucht, Zuversicht zu ziehen, mir Mut zuzusprechen. Und ich denke, bei aller Kritik, dass die Astrologie dabei wohl tatsächlich helfen kann. Ja, ich würde sagen, sie ist eine Art von Besinnungstechnik: Indem ich die Sterne befrage, hole ich mir eine – vermeintlich – objektive, quasi naturgebene Perspektive über mein kuscheliges kleines Leben ein. Und plötzlich fallen mir ganz andere Wege, neue Tricks und Selbstbilder ein, auf die ich von alleine nicht gekommen bin. Jedes Horoskop lässt sich so, aber auch so deuten, und vermutlich sehe ich darin immer nur das, was ich gerade sehen will. Die Beschäftigung damit ist letztlich also vor allem ein intensives Selbstgespräch.
Der Vorfall am Anfang, der alles ins Rollen bringt, ein Batzen Geld, der plötzlich vor der Tür steht, ermöglicht Carla etwas, das sie sich vorher nicht getraut hätte: den – vermeintlichen – Schritt in die Freiheit. Doch sie sagt auch »Ich besitze ein Geheimnis, das mich besitzt.« Wie kann man wirklich frei und unabhängig sein? Was ist Carlas Definition davon, was Ihre? Und natürlich, ganz plakativ gefragt: Geht das überhaupt in unserer Gesellschaft?
Die Idee von Freiheit zählt ja zu den größten menschlichen Hoffnungen seit eh und je – die Sehnsucht, irgendwie loszukommen von den großen und kleinen Zwängen, die das irdische Dasein beschweren. Kein Mensch ist eine Insel, wie der britische Metaphysiker John Donne einmal gesagt hat: Jeder ist immer auch Teil einer Gesellschaft und muss sich mit deren Spielregeln arrangieren. Ich denke, dass die liberalen Demokratien, in denen wir in Europa bislang lebten, die größten Potenziale für individuelle Freiheit geboten haben. Doch da ist immer auch die ›Macht des Marktes‹: Hört man den Börsennachrichten zu, klingt es oft so, als ob von einer Naturgewalt die Rede wäre, von einem göttlichen Gesetz, an dem sich leider nichts ändern lässt. Der harte Wettbewerb, die Auslese, die nackte Existenzangst und die Suche nach Sündenböcken: Auch deshalb erleben wir gerade eine starke Hinwendung zu autoritären Führungsfiguren, nach irgendeinem Machtmensch, der endlich einmal ›aufräumt‹. Der Kosmos hat in diesem Sinne auch etwas Autoritäres an sich: Er ist die Über-Instanz, der ich vielleicht vertrauen kann oder vertrauen muss, wenn alles andere mich enttäuscht.
Carla wechselt von ihrem klassischen wie eintönigen »Bullshit-Job« in die Selbstverwirklichung als erfolgreiche Astrophilosophin, bei der sie Menschen sowohl etwas mitgeben als auch endlich selbst im Mittelpunkt stehen kann. Eine Entwicklung, die ihr offenbar Freude bereitet. Lebt Carla so etwas wie die Erfüllung des kapitalistischen Versprechens?
Ja, sie versucht es zumindest. So wie Carla Astrologielehrbücher studiert hat, so zieht sie sich auch diverse Start-up-Ratgeber rein. Sie will sozusagen das Beste aus sich machen, genauso, wie es angeblich auch alle anderen tun. Das ist wahrscheinlich die größte Enttäuschung in Carlas Leben: Sie zählt zu der Altersgruppe, die einst, zwischen den 1970er und 1990er Jahren, von der sozialdemokratischen Bildungsexpansion profitiert hat, stammt aus ärmlichen Familienverhältnissen, konnte aber trotzdem, als Erste in ihrer Familie, Philosophie studieren und war zunächst auch ziemlich stolz darauf. Bis sie feststellen musste, dass so eine geisteswissenschaftliche Ausbildung längst nichts mehr zählt und sich kaum Geld damit verdienen lässt. Der berühmte Taxifahrer mit Doktortitel, die Kellnerin mit einem Abschluss in Kunstgeschichte, der examinierte Historiker, der als freier Journalist 50-Euro-Aufträge erhält und sich auf Event Organisation umschulen lässt: All diese Figuren sind real, mitten unter uns, massenhaft. Von daher ist Carlas Story auch eine Geschichte der Ernüchterung: Eine Menge gesellschaftlicher Versprechen, an die sie geglaubt hat, sind zerborsten, waren nichts als rosarote Fantasien.
In Ihrem Roman wird immer wieder festgestellt, wie wichtig Menschen das Gesehenwerden und wie groß die Angst vor der eigenen Überflüssigwerdung ist. Kann man sagen, dass es das ist, was Carla am Ende selbst antreibt?
Da sich zum Beispiel die Künstliche Intelligenz immer weiter in den Alltag drängelt, könnte man ja wirklich auf diesen Gedanken kommen: Eines Tages werden eh Algorithmen unsere Leben übernehmen, sie funktionieren viel verlässlicher als Menschen, bald sind wir alle bloß noch als Avatare unserer selbst unterwegs. Und je größer die Angst des Menschen, vom Thron der Schöpfung verstoßen und durch Technik ersetzt zu werden, desto größer wohl auch seine Sehnsucht nach dem ›Echten‹, dem angeblich Authentischen, nach Feelings, Emotions und der Nachsicht mit menschlichen Fehlern. Carla funktioniert in dieser Situation als eine ›Seelen-Dienstleisterin‹, könnte man sagen. Sie gibt ihren Astro-Kunden das Gefühl, etwas Besonderes zu sein – und genießt umgekehrt die Erfahrung, wenigstens im Kleinen vielleicht etwas bewirken zu können.
Carla ist eine »singuläre Frau« und dabei eine ungewöhnliche Frau in der modernen Literatur noch dazu. Sie ist »nicht mehr jung, noch nicht alt«. Wenn solche Frauen sonst als Protagonistinnen in der Literatur vorkommen, dann häufig im Zusammenhang mit Familie, Beziehungswunsch und/oder Kindern. Hier darf die Protagonistin alleine stehen und sich ausprobieren. Inwiefern war der Name »Mittmann« – »mit Mann« – eine Anspielung auf Ihr letztes Buch »Die singuläre Frau«? Stimmt der Eindruck, dass Sie großen Spaß daran hatten, Ihren Roman mit Anspielungen zu spicken? Und: Haben Sie Carla ganz bewusst so ungewöhnlich aus Ihrer Fantasie gestampft? Bzw. wie wichtig war es Ihnen, dass Ihre Protagonistin all das verkörpert?
Diese Frage freut mich sehr – auch, weil ich mich fast ein bisschen darüber ärgere. Ich finde nämlich gar nicht, dass Carla eine ›ungewöhnliche‹ Figur ist. Eine Menge Frauen leben ohne feste Partnerschaft und stellen ganz andere Dinge in den Mittelpunkt ihres Alltags, als ständig nur ›den Richtigen‹ zu suchen, irgendeinem Schönheitsideal nachzueifern oder mit dem Älterwerden zu hadern. Dafür haben viele Frauen weder Zeit noch Lust, sie hegen ganz andere Interessen. Nur in der Werbung und in der Schrottliteratur werden Frauen immer noch anders dargestellt. Wenn die Carla aus meinem Roman den Blick auf Frauen also ein wenig erweitert, fände ich das wunderbar! Sie kommt mir, ehrlich gesagt, vor eine ganz normale gute Bekannte – manches haben wir auch gemeinsam. Und ihr Nachname, ›Mittmann‹, hat tatsächlich eine Bedeutung: Einst wurden Tagelöhner so genannt, Leute, die sich von Job zu Job hangelten, um irgendwie durchzukommen.
Die Protagonistin macht auf mehreren Ebenen eine ziemliche Reise durch: Von Anfang an steht sie der Astrologie zweifelnd gegenüber, als Philosophin ist sie aber schon früh fasziniert, wer die Leute sind, die sich damit beschäftigen. Sie legt Horoskope und astrologische Persönlichkeitsanalysen an, ohne selbst daran zu glauben. Je bekannter sie wird, desto mehr scheint sie jedoch auch für sich selbst nach Anhaltspunkten, Hinweisen und Erklärungen für ihren eigenen Erfolg zu suchen. Was hat Sie an diesem Weg fasziniert? Inwiefern muss man an etwas glauben, um darin erfolgreich zu sein?
›Ich weiß, dass ich nichts weiß‹ lautet einer der Grundsätze der Philosophie, schon seit Platon und Sokrates – und mit dieser ewigen Unsicherheit schlägt auch meine Heldin sich herum. Sie ist der grüblerische Typ, hat das Zeug zur Intellektuellen, sieht aber, dass alles Denken oft kaum hilft, wenn es ums nackte Überleben geht. ›Transzendenz muss man sich leisten können‹, sagt Carla an einer Stelle ganz nüchtern. Sie betrachtet nicht nur ihre Umgebung, sondern auch ihre eigene mickrige Existenz mit einer gewissen geistigen Überheblichkeit, neigt zu Sarkasmus und Besserwisserei. Aber eigentlich sehnt sie sich danach, endlich einmal mit all ihren Eigenheiten ›erkannt‹ zu werden und irgendwo dazu zu gehören, und so weicht ihr Widerstand gegen die Astrologie nach und nach auf. Es ist so bequem, so wohlig und gemütlich, sich vorzustellen, dass es irgendwo im Kosmos jemand gut mit einem meint, nicht wahr? Es wäre so schön, endlich klare Antworten auf all die nebligen Fragen zu erhalten.
Im Gegensatz zum gängigen Astro-Bild, das man im Kopf hat, ist Carla weder an Räucherstäbchen noch an Alternativmedizin (Stichwort: „Schulmedizin ist ein Himmelsgeschenk“) interessiert, sie orientiert sich lieber an den glamourösen Auftritten der Schweizer Astrologin Elizabeth Teissier aus den 80ern. Inwiefern ist das vielleicht auch ein Gegenentwurf zu aktuellen Astrologie-Tendenzen? Was hat Sie speziell an Teissier gereizt?
In meiner Teenagerzeit hat mich diese glamouröse Person, Elizabeth Teissier, sehr fasziniert. Damals lief im öffentlich-rechtlichen deutschen TV ja tatsächlich diese Sendung, die ›Astro-Show‹, in der Prominente wie Udo Jürgens ihre Horoskope von Teissier ausdeuten ließen, vor einem Millionenpublikum. Teissier wirkte dabei überhaupt nicht bieder oder verstrahlt, sondern weltläufig, charmant und vor allem sehr gebildet. Sie hat in der Tat einen Doktortitel in Soziologie. Eine wirklich weise Frau, die über geheime Kenntnisse verfügt: So kam sie mir vor. Heute hat die Astrologie ein etwas anderes Image, das stimmt. Sie wird oft in einen stressigen Coaching-Zusammenhang gebracht, nach dem Motto: Arbeite nur fleißig an dir selbst, und alles wird gut. Oder es werden verschiedene indigene Folkloren bunt zusammengemixt, hier ein bisschen Schamanentum, da ein paar ätherische Öle. Kürzlich habe ich wieder mal eine dieser Esoterikmessen besucht: alles voll mit pseudo-medizinischen Geräten und Angeboten, von ›Zirbeldrüsenaktivierung‹ über ›Aurafotografie‹ bis ›Prana-Heilung‹. Das war schon ganz schön erschreckend, zu sehen, wie hilflos manche Menschen sich offenbar fühlen, wie sehr sich irgendeine praktische Methode wünschen, mit der das Leben etwas leichter werden könnte.
Mit dem Alter erhöht sich naturgemäß die Anzahl der nicht umgesetzten Möglichkeiten. Hängt Carla noch ihrem ersten nicht-eingeschlagenen Weg nach, dem Studienabschluss, der ihr kurz vor dem Ende verwehrt wurde?
Die große Frage ›Was wäre gewesen wenn?‹ treibt, glaube ich, viele Menschen um, spätestens in der Lebensmitte. Man kommt ins Grübeln: Ist mein Dasein wirklich von meinem freien Willen bestimmt? Oder folge ich letztlich doch nur den Vorgaben, die meine Herkunft, meine Klasse, meine Hautfarbe, mein Geschlecht mir diktieren? Das rührt wieder an der Idee von Freiheit: Inwieweit bin ich nur ein Spielball der Verhältnisse? Gibt es so etwas wie Schicksal? Oder grätscht ab und an bloß ein dummer Zufall herein und dreht alles in eine andere Richtung, als ich eigentlich wollte? Carla war schon kurz davor, als frustrierte Aushilfskraft in einem ungeliebten Büro zu versauern. Aber dann … bäumt sie sich sozusagen noch einmal auf. Sie gibt die vermeintliche Sicherheit der Festanstellung auf, macht sich als Solo-Unternehmerin im Feld Astrologie selbstständig – und knüpft damit an die Ideen an, die sie als junge Frau fasziniert haben. Was habe ich schon zu verlieren, denkt sie sich und spielt dieses Experiment einmal durch. Um dann, am Ende zu sehen … naja, das möchte ich hier jetzt nicht verraten.
Zeigt uns »Stars«, dass es am Ende eigentlich egal ist, woran wir glauben? Dass der Glaube an etwas Berge bewegen kann, speziell in unsicheren Zeiten – egal wie irrational? Wie sehen Sie das?
Nein, so optimistisch bin ich, ehrlich gesagt, nicht. Ich habe zwei Jahre an dem Roman gearbeitet, während Donald Trump sich zurück ins Weiße Haus log und auch hier in Europa der Irrationalismus stetig zunahm. Nehmen wir nur den überall wieder erblühenden Nationalismus, den Rassismus und den Sexismus, den billigen Glauben, dass manche Menschen anderen gegenüber ›von Natur aus‹ überlegen seien: Jahrzehnte lang war solcher Aberglaube passé, jetzt rülpst er sich an allen Ecken wieder hoch. Wissenschaftliche Fakten werden lautstark angezweifelt, wenn sie nicht in die persönliche Weltsicht passen und das eigene Leben etwas unbequemer machen. Statt sich um wirklichen Fortschritt zu bemühen, sehnen sich viele Leute wieder nach einem märchenhaften ›früher war alles besser‹ – auch wenn niemand sagen kann, wann genau dieses Früher gewesen sein soll. Ist die Zeit gemeint, in der die Prügelstrafe noch okay war und Siebzigstundenwochen für Arbeiter der Normalfall? Nein, nein, ich denke leider nicht, dass wir mit der individuellen ›Arbeit an uns selbst‹ sehr viel weiter kommen. Insofern sind die »Stars« durchaus ein kritischer Kommentar zum Hier und Heute. Ich denke aber, es liest sich ganz unterhaltsam. Das habe ich jetzt oft gehört: Dass Leute beim Lesen ziemlich oft lachen mussten.
Katja Kullmann, 1970 geboren, lebt als »Erzählerin, Essayistin, Passantin« in Berlin. Für den Bestseller »Generation Ally. Warum es heute so kompliziert ist, eine Frau zu sein« erhielt sie 2003 den Deutschen Bücherpreis in der Kategorie Sachbuch. Zuletzt erschien 2022 ihr Essay »Die Singuläre Frau«.
—

Katja Kullmann
Stars
Hanser Berlin, 256 Seiten