Eine Geschichte vom Abschied, vom Sterben, aber auch vom Leben und vom Lieben. In »Frieda« lässt Isabella Feimer die fiktionalisierte Lebensgeschichte ihrer Großmutter kurz vor deren Tod noch einmal vorüberziehen, die Kindheit, die Nachkriegszeit, die große Liebe, die sie geheim halten musste. Foto: Manfredo Weihs.
Todtraurig und zart-schön wechselt Feimer in ihren Erzählperspektiven zwischen den Jahren ab 1926 und dem Sterbejahr 2007, poetisch und friedvoll durchlebt sie den Abschied im Schreiben erneut. »Wir sind nicht unsere Erinnerungen, wir gestalten sie«, sagt sie im Interview mit Buchkultur, und: »Manche Orte schreien nach einer Geschichte«. Ein Gespräch über den Einfluss von Genres, wiederauftauchende Figuren in Feimers Werk und vor allem über den notwendigen, ungeschönten Blick auf die Vergangenheit.
Buchkultur: Sie sind in allen möglichen Textsorten zuhause, schreiben auch Gedichte. Wonach gehen Sie da, welche Gedankensprengsel werden zum Gedicht, welche zum Roman? Arbeiten Sie auch gleichzeitig an mehreren Projekten?
Isabella Feimer: Ja, ich arbeite gleichzeitig an mehreren Projekten, aber immer gibt es diesen einen Text, dem ich die meiste Aufmerksamkeit widme. Die anderen Projekte sind eher Ideen, an denen ich dann gelegentlich notiere und dann schreibe, wenn der – nennen wir ihn – Haupttext einmal Ruhe von mir braucht.
Wenn eine Idee da ist, zeigt sie mir die Form, in der sie geschrieben werden will. Ein Gedicht, zum Beispiel, zeigt sich in mir in einem starken Gefühl und im sprachlichen Minimalismus, den ein – schönes Wort – »Gedankensprengsel« mit im Gepäck hat. Bei Romanen ist das ganz anders. Meistens beginnen sie in mir mit einem Bild, ähnlich einem Filmstill, das mir die Hauptfigur in einer bestimmten Situation zeigt, und dann entsteht nach und nach die Geschichte dazu. Manchmal sind es aber auch Orte, an die ich komme, und die schreien dann nach einer Geschichte.
Ich habe »Frieda« am Ende, mit der gesamten Geschichte vor Augen, als Liebesgeschichte gelesen – anfangs verbirgt diese sich allerdings noch in der Lebensgeschichte. Hatten Sie anfänglich schon die Liebesgeschichte im Sinn, schreiben Sie Ihre Bücher an diesen Kategorien entlang, oder hat sich die Liebesgeschichte doch aus der Lebensgeschichte herauskristallisiert?
Schön, dass Sie der Liebesgeschichte den Vorzug geben. »Frieda« ist das auch. Für mich in allen Facetten, mit Erfüllung, aber auch Verlust, mit Zärtlichkeit und den groben Aspekten, die Liebe mit sich bringt. Begonnen hat mein Arbeitsprozess allerdings mit der Idee, eine Geschichte über das Sterben zu schreiben. Eine Art Sterbebegleitung mit Worten. Ein Totenlied, und ja, es hat sich im Schreiben verändert, und irgendwann gab es den Punkt, an dem ich der Figur die Möglichkeit zur Liebe geben wollte. Und somit auch den Lesern und Leserinnen.
Prinzipiell suche ich in den längeren Prosaarbeiten weniger nach Kategorien, sondern versuche Genres einfließen zu lassen. Bei »Trophäen« war es das Kunstmärchen, bei »Stella maris« die Science-Fiction. Aspekte wie diese bereichern für mich das Erzählen und lassen die Figuren unkonventionelle Wege gehen.
Ein wenig erinnert mich der Zugang zu dieser Biografie an das Buch »Ein ganzes Leben« von Robert Seethaler, aber auch an die »Bagage« von Monika Helfer. Der Blick in die Vergangenheit, der (wie bei Helfer) auch vom liebenden Blick der Nachfahren lebt. Waren das Vorbilder für Ihr Schreiben?
Das sind großartige Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe. Aber nein, sie waren mir nicht Vorbild. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich in »Frieda« mit einem liebenden Blick in die Vergangenheit schaue. Ich würde diese Frage fast verneinen. Der Blick ist eher ungeschönt.
Ich habe schon einmal einen ähnlichen, wenn auch in der Geschichte ganz anderen Blick versucht, nämlich in dem Roman »Zeit etwas Sonderbares«, der 2014 bei Septime erschienen ist. Hier taucht Frieda bereits als Figur auf, als Nebenfigur, deren Geschichte ich immer weiterschreiben wollte. Ich dachte damals, mein Schreiben wird der Komplexität der Figur nicht gerecht, auch nicht der Komplexität meiner Großmutter, auf der die Figur der Frieda basiert. Erzählerische Gerechtigkeit heißt das, oder?
Am Ende des Buches finden die Leser/innen ein Foto Ihrer Großmutter, Sie erklären dazu, sie habe Sie zu dem Roman inspiriert. Was hat Sie, im Unterschied zu einer zeitgenössischen Biografie, an der Bearbeitung der Vergangenheit gereizt? Wie haben Sie dafür recherchiert?
Ich denke, der Blick in die Vergangenheit erzählt immer auch die Gegenwart. Zum Beispiel die Einsamkeit, die Frieda in ihren letzten Stunden erlebt, das Alleingelassensein. Die Kriegswunden und Trümmerwelten, in denen sich die Figuren bewegen müssen. Dieser Blick in die Ferne und in der Zeit zurück bringt vermutlich Klarheit für den Blick auf die Gegenwart.
Die Zeit, in der die Geschichte spielt, ist eine, die mich meine Kindheit über begleitet hat, meistens im Schweigen darüber. Nur selten sprachen meine Großeltern über den Krieg. Ich glaube, dieses Schweigen hat mich schon damals neugierig gemacht. Ich wollte wissen, worüber sie schwiegen, will es auch jetzt noch wissen. Es ist also eine ongoing Recherche, die lesen heißt, zuhören, weiter lesen, weiter zuhören, denen vor allem, die Teil dieser Zeit gewesen sind.

Wie stark haben Sie sich an Erzählungen Ihrer Familie orientiert, wie viel Freiheit haben Sie sich beim Schreiben gelassen?
Im Schreiben habe ich mir sehr große Freiheit genommen. Ich habe mich lediglich an den Eckdaten orientiert, an den Familienkonstellationen, im Visuellen an den Fotos, die ich aus dieser Zeit habe. Aber »Frieda« ist ja keine Biografie, es ist eine fiktive Geschichte, in der ich mit Möglichkeiten spielen wollte, mit Wünschen, mit Begehr, und letztendlich mit Erinnerung an sich. Die für mich spannendste Frage in dieser Arbeit war, wie sehr der eigenen Erinnerung zu trauen ist. Auch Erinnerung kann zu einer Fiktion gemacht werden. Wenn wir uns ehrlich sind, machen wir sie ständig dazu. Wir schmücken aus, wir lassen weg, wir täuschen vor. Wir sind nicht unsere Erinnerungen, wir gestalten sie.
Auch nur der Gedanke, eine Frau zu lieben, scheint für die Frieda im Buch so tabuisiert, dass sie es kaum klar artikuliert. Wie sind Sie an dieses Thema herangegangen? Finden Sie, es gibt ein Ungleichgewicht in der Thematisierung von weiblicher und männlicher gleichgeschlechtlicher Liebe?
Dass Frieda diese Liebe nicht artikulieren kann, ist ihren Umständen geschuldet, dem Aufwachsen in der strengen Familienhierarchie, dem Leben am Land, der Zeit, in der man sich in vorgegebenen Mustern zu bewegen hatte. Ich glaube auch nicht, dass ich an das Thema »herangegangen« bin, es hat sich aus der Figur und ihrem Gefangensein in den gesellschaftlichen Strukturen heraus entwickelt.
Ob es ein Ungleichgewicht in der Thematisierung gibt, ist eine schwierige Frage, die ich ad hoc gar nicht beantworten kann. Ich finde es schrecklich, dass gleichgeschlechtliche Liebe überhaupt noch ein Thema ist, das Hass hervorbringt, Gewalt und Unverständnis. Das verstehe ich nicht. Wir, als Gesellschaft und als Individuen, sollten schon viel weiter sein.
Man sagt, bevor man stirbt, zieht das Leben noch einmal an einem vorbei. Die Beschreibung von Frieda, die 2007 in ihrem Bett liegt und weiß, dass sie bald sterben wird, hat etwas wunderbar Friedliches, Beruhigendes. Diente dieser Roman auch einer allgemeinen Auseinandersetzung mit dem Tod? Lag dieser Auseinandersetzung vielleicht sogar ein Schlüsselerlebnis zugrunde?
Auch ich habe in diesem Text ein wenig Frieden gefunden, habe meinen Frieden damit gemacht, dass der Tod Bestandteil des Lebens ist. Mit Trauer. Dass man Menschen, die einem nahe sind, gehen lassen muss. Alle, über die ich schreibe, die ich in dieser Geschichte fiktionalisiere, sind bereits gestorben. Manche schon vor langer Zeit. Also ja, es war eine Art Loslassen, ein Gehenlassen. Und traurig, aber auch befreiend war es, sich mit diesen Worten noch einmal zu verabschieden. Jeder dieser Abschiede und auch der tatsächlich gewesene Abschied kommen und kamen einem Schlüsselerlebnis gleich.
Gibt es schon neue Projekte von Ihnen, von denen Sie erzählen können? Welche Themen beschäftigen Sie zurzeit?
Zurzeit versuche ich mich wieder an Gedichten und an Prosa, die irgendwann einmal eine Geschichte wird. Beides ist eine Auseinandersetzung mit dem Topos Ozean. Und ich bin gerade in der finalen Überarbeitung eines Romans, der im kolumbianischen Dschungel spielt und der politische Unruhen, aber auch Missbrauch zum Thema hat.
Isabella Feimer, 1976 geboren, studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien und arbeitet seit 1999 als freie Theaterregisseurin und Schriftstellerin. Sie verfasst Romane, Lyrik, Reiseprosa und Essays. Für ihre Romane erhielt sie zahlreiche Stipendien und Preise, u.a. war sie für den renommierten Bachmann-Preis nominiert. Zu ihren Inspirationsquellen zählen ihre Reisen und die Beschäftigung mit Bildender Kunst. Zuletzt erschienen: Cadavre exquis (Erzählung, Literaturedition NÖ 2021) und Langeweile (Essay, K&S 2022).
—
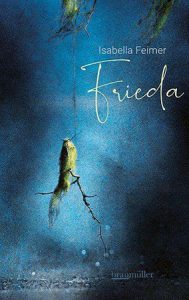
Isabella Feimer
Frieda
Braumüller, 176 S.













