Sprachbarrieren spielen in Elisa Shua Dusapins neuem Roman »Die Pachinko-Kugeln« eine entscheidende Rolle. Darin besucht eine junge Frau aus der Schweiz namens Claire ihre Großeltern in Tokio und gibt dort einem Mädchen, Mieko, Nachhilfe in Französisch. Foto: Yvonne Bohler, Editions Zoe.
Claires Großeltern sind im Zuge des Koreakriegs nach Japan geflohen und haben dort immer wieder massive Ausgrenzung und Diskriminierung erlebt, das Pachinko des Großvaters spielt dabei eine ambivalente Rolle. Die Verständigung ist schwierig: Claire spricht selbst kein Koreanisch, die Großmutter wiederum weigert sich, Japanisch zu sprechen. Im Interview mit Buchkultur erzählt die Schweizer Schriftstellerin von ihrer Arbeit an dem Buch und ihrem persönlichen Zugang zu fremden und heimischen Kulturen.
Buchkultur: Wie genau funktioniert eigentlich das Pachinko-Spiel? Und warum haben Sie es sich als zentrales Motiv in Ihrem Buch auserwählt? Darin lässt sich nachlesen, dass es koreanische Einwanderer erfunden haben, die vom japanischen Arbeitsmarkt ausgeschlossen wurden. Die »Zainichis«, die Gemeinschaft der Koreaner in Japan, mussten somit keine Steuern zahlen. Ist das nach wie vor so?
Elisa Shua Dusapin: Pachinko ist eine Maschine, die wie ein vertikaler Flipper aussieht. Hunderte von Murmeln schießen aus dem oberen Teil des Tisches und fallen in eine Reihe von Löchern, die die Preise bestimmen, die der Spieler gewinnt. Da Glücksspiel in Japan offiziell verboten ist, tauschen die Spieler diese Preise außerhalb des Lokals gegen Geld ein. Tatsächlich zahlen die Koreaner in Japan keine Steuern für den Betrieb eines Pachinko-Etablissements, was ihre Vorherrschaft auf dem Markt begünstigt. Das ist noch heute so. Als Eurasierin, die sich weder in Asien noch in Europa zu Hause fühlt, hat mich die Geschichte des Pachinko in Verbindung mit dem Schicksal der Koreaner in Japan berührt. Koreaner/innen haben in Japan einen speziellen Identitätsstatus, sie gelten als Verräter an der koreanischen Nation und werden nicht wirklich in Japan anerkannt.
Die Zainichis, zu denen auch Claires Großeltern gehören, wurden entweder unter japanischer Besatzung deportiert oder sie flohen vor dem Krieg. Unter welchen Bedingungen leben die Koreaner im heutigen Japan? Was hat Sie nach Japan geführt und was hat Ihr Interesse an diesem Land geweckt?
Auch heute noch sind die Spannungen zwischen Korea und Japan spürbar. Koreaner/innen in Japan sind regelmäßig Opfer sozialer Diskriminierung in einem Land, in dem rassistische Äußerungen nicht gesetzlich geahndet werden. Der Dokumentarfilm »Counters« von Lee Il-ha aus dem Jahr 2017 handelt davon. Ich persönlich werde immer sofort für eine japanische Eurasierin gehalten. Wenn ich meine koreanischen Wurzeln erwähne, stoße ich immer auf eine Reaktion. Sie ist nicht unbedingt negativ, aber allein die Existenz dieser Reaktion zeigt, dass die Verbindung zwischen diesen beiden Ländern nicht harmlos ist. Ich habe acht Jahre lang mehrere Monate im Jahr in Japan gelebt, um meinen damaligen Lebensgefährten zu begleiten, der dort für das Schweizer Radio und Fernsehen als Dokumentarfilmer arbeitete. Dadurch konnte ich mich mit vielen Themen intensiv auseinandersetzen.
Die Beziehung zwischen Claire und ihren Großeltern leidet unter einem großen Hindernis: der Sprache. Während Claire viele Sprachen beherrscht (außer Koreanisch), weigern sich ihre Großeltern, Japanisch zu sprechen (ihre Urgroßmutter schneidet sich sogar die Zunge heraus, um sich nicht an die japanische Kultur anzupassen). Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass eine Sprache trennen kann? Da Sie mehrsprachig sind, nehme ich an, dass Sie sie eher als ein integratives Instrument erlebt haben.
Ich bin mit fünf Sprachen aufgewachsen. Da ich für mehrere Familienmitglieder dolmetschte, wurde ich schon früh mit der Macht einer Sprache, aber auch mit ihren Grenzen konfrontiert. Nur weil man auf sprachlicher Ebene eine Sprache teilt, heißt das nicht, dass man sich zwangsläufig auch versteht. Jede Sprache hat ihr kulturelles Gepäck und jedes Individuum seine damit verbundene Geschichte, was zwangsläufig zu kommunikativen Missverständnissen führt, die für mich als Schriftstellerin spannend zu erforschen sind. Mein Verhältnis zur französischen Sprache ist besonders, da ich nur auf Französisch schreibe, meine Figuren aber andere Sprachen sprechen. Ich übersetze mich unablässig selbst.
Sie wissen viel über Japan und die japanische Kultur. Zum Beispiel, dass man sich nicht küsst, oder über Kokeshi-Puppen. Haben Sie das auf Ihren Reisen gelernt? Wie lernt man auf Reisen am besten über eine Kultur?
Ich habe diese Dinge erfahren, indem ich tief in das Land eingetaucht bin. Ich habe Dokumentarfilmer/innen und Journalist/innen begleitet und aus persönlichem Interesse Interviews mit bestimmten Gruppen geführt. Ich bin extrem neugierig und gehe den Themen so tief wie möglich auf den Grund, wenn ich schreibe.
»Heidi« wirkt in Ihrem Roman wie ein Platzhalter, ein Ersatz für die Schweizer Kultur. Henriette, die Mutter des Kindes, das Claire babysittet, ist fasziniert von dem Buch und möchte, dass ihr Kind Mieko in der Schweiz zur Schule geht, gemeinsam besuchen sie das »Heidiland« in der Nähe von Tokio. Sie selbst wurden ja auch zur Kulturbotschafterin Ihres Kantons ernannt – was kann man also von Heidi über die Schweiz lernen? Und überhaupt: Gibt es das Heidiland wirklich und waren Sie dort? Ich bin neugierig!
Dieses japanische Heidiland gibt es wirklich, ja! Das hat mich fasziniert. Wie stellt man ein Land am anderen Ende der Welt dar? Die Idee der Repräsentation, Projektion, Fantasie fasziniert mich. Das gilt auch für die Vorurteile, die wir über verschiedene Kulturen haben … Meine Figuren werden in ihren Interaktionen genau damit konfrontiert. Mit Heidi und der japanischen Vorstellung der Schweiz wollte ich die Sehnsucht nach einer Ferne, nach einer Idealisierung heraufbeschwören …
Ihre Sprache wird oft als zurückhaltend, präzise, prosaisch und elegant beschrieben, Ihre Bücher haben nicht mehr als 200 Seiten. In einem Interview sagten Sie kürzlich, Sie wollen nicht mehr erzählen, als da ist. Können wir uns vorstellen, dass Sie sehr sorgfältig schreiben, dass Sie sehr genau an Ihren Texten arbeiten – und spiegelt das auch Ihre Sicht auf die Welt wider: Rational und präzise?
Im Gegenteil, ich bin ein Konzentrat überbordender Emotionen, überhaupt nicht rational, sondern verträumt, ich verbringe meine Zeit damit, mir Geschichten auszudenken und mich für alles zu begeistern, was auf sehr fantasievolle Weise aus dem Rahmen fällt. Eigentlich erkenne ich mich in meinen Büchern kaum wieder, höchstens in der Hypersensibilität der Figuren. Das ist etwas Mysteriöses, das ich mir nicht erklären kann … Mein knapper, präziser Schreibstil ist eher darauf zurückzuführen, dass mir das Schreiben nicht leicht fällt.
»Die Pachinko-Kugeln« ist Ihr zweites Buch, das auf Deutsch erscheint. Ist es ein seltsames Gefühl, im eigenen Buch in einer anderen Sprache zu blättern? Wie wurden Ihre Romane in der deutschsprachigen Schweiz aufgenommen? Und: Was halten Sie von Ihren deutschen Covern, haben Sie diese zusammen mit dem Verlag ausgewählt?
An der Auswahl der Cover war ich nicht beteiligt, das macht der Verlag. Bei den Übersetzungen ziehe ich es vor, loszulassen und die Leute aus dieser anderen Kultur machen zu lassen. Jedes Land hat seine eigenen Traditionen und einen anderen Markt, da muss man vertrauen. In der Deutschschweiz wird mein Werk sehr gut aufgenommen, ich fühle mich geehrt. Genauso wie ich mich von der deutschen Rezeption geehrt fühle. Ich wurde unter anderem zum Internationalen Literaturfestival in Berlin im September eingeladen, das Publikum war unglaublich herzlich.
Zu guter Letzt: Gibt es etwas in der medialen Rezeption über Ihre Bücher, das Sie nicht mehr hören wollen?
Ich habe nichts didaktisch zu vermitteln, also beantworte ich gerne alle Fragen, auch wenn sie immer wieder auftauchen. Ich entwickle mich weiter, also sind meine Antworten jedes Mal anders. Das Publikum ist von Land zu Land unterschiedlich, was spannend ist.
Elisa Shua Dusapin, geboren 1992, wuchs als Tochter eines französischen Vaters und einer südkoreanischen Mutter in Paris, Seoul und Porrentruy auf. Sie hat am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert. Für ihre Romane »Ein Winter in Sokcho« und »Die Pachinko-Kugeln« (beides Blumenbar) erhielt sie u. a. den »Robert-Walser-Preis«, den »Schweizerischen Literaturpreis« und den »National Book Award for Translated Literature« 2021.
—
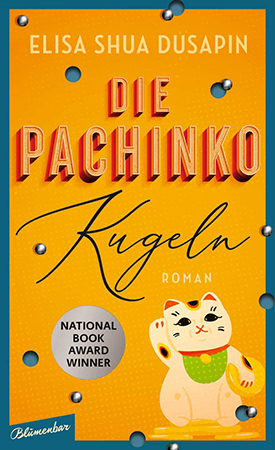
Elisa Shua Dusapin
Die Pachinko-Kugeln
Ü: Andreas Jandl
Blumenbar, 144 S.













