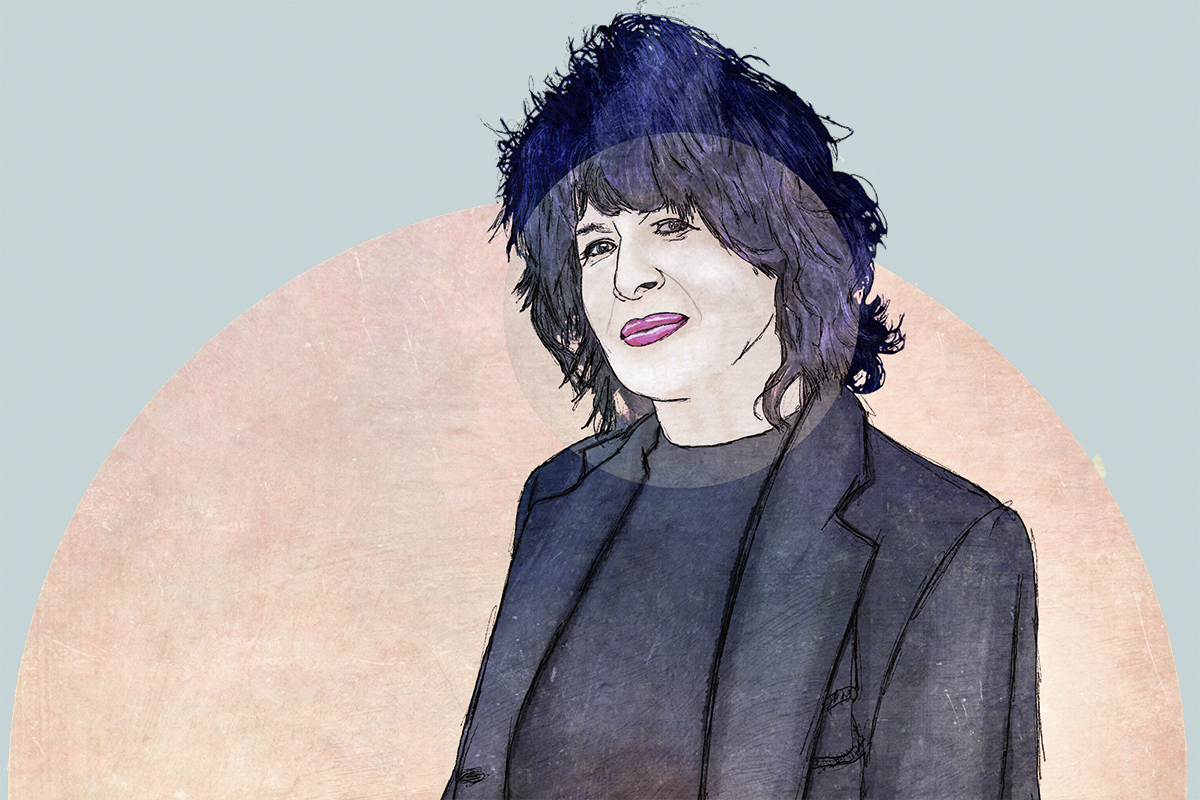Monika Helfers berührender Roman „Die Bagage“ ist ein Juwel, in dem sie die Geschichte ihrer Familie zu großer Literatur verdichtet. Vom Glück des Zusammenhalts gegen die Engherzigkeit der Zeit: Wir haben die stille, große österreichische Erzählerin, die konsequent auf der Seite der Außenseiter und Randfiguren, der Heimatlosen und Bedürftigen schreibt und ihnen eine Stimme gibt, dazu ausführlich befragt. Illustration: Jorghi Poll.
Buchkultur: „Die Bagage“ erzählt, auch fiktiv, die Geschichte Ihrer Familie, vor allem Ihrer Großeltern und deren Kinder. Sie haben die Geschichte schon lange im Kopf mit sich herumgetragen?
Monika Helfer: Ja, die habe ich schon sehr lange im Kopf. Ich musste wirklich so alt werden, um sie zu schreiben. Man will ja die eigenen Leute nicht vor den Kopf stoßen. Und so dachte ich mir, ich warte, bis sie nicht mehr leben, damit ich niemanden kränke.
Sie wuchsen nach dem frühen Tod Ihrer Mutter bei Ihrer Tante Kathe auf?
Ja, als meine Mutter gestorben ist, sind meine zwei Schwestern und ich zu ihr gekommen. Und die hatte uns dann bis ich fünfzehn war.
Die Kinder Ihrer Großeltern und vielleicht auch Sie nach dem frühen Tod Ihrer Mutter: Durften sie, durften Sie je Kind sein?
In meiner Generation war das Kindsein im Hintergrund. Man war schon Kind, man hat gespielt, aber man war auch eingespannt zu Hause. Wir mussten auch viel helfen. Es gab nicht so viel Freizeit, und vor allem gab es kein Geld. Ich denke mir jetzt manchmal, das war vielleicht ein Segen. Denn wenn ich heute Kinder anschaue, meine Enkel – die haben alles. Wir hatten überhaupt nichts. Mein Vater war sehr weltfremd, als meine Mutter gestorben ist. Ich habe zu Weihnachten ein kleines Büchlein, ein Schmuckbändchen, von ihm bekommen, da war ich neun Jahre alt: Johann Wolfgang von Goethe. Ich konnte damit nichts anfangen. Das war so hilflos von ihm. Ich habe da nicht mal reingeschaut. Ein Buch gab es immer, aber sonst gab es nichts. Als wir die erste Banane hatten, dachten wir, das gibt es gar nicht, wie groß so etwas ist. Unglaublich. Aber was ich – damals nicht, aber jetzt in der Erinnerung – so schön finde: Dass das Wünschen so wichtig war. Ich habe mir immer etwas gewünscht, und habe aber gewusst, dass ich es ohnehin nie bekomme. Aber das Wünschen war so etwas Großes. Sich immer wünschen, vielleicht fahre ich ja doch einmal wie alle meine Schulkollegen nach Italien auf Urlaub ans Meer. Das war natürlich überhaupt kein Thema. Wir sind nie auf Urlaub gefahren. Aber immer dieses Wünschen. Die Kinder heute wünschen sich ja nichts mehr. Sie wünschen sich vielleicht etwas zwei Stunden lang, und dann haben sie es schon in der Hand. Ich glaube, es ist total wichtig, sich etwas wünschen zu können.
Ist es auch ein großer Unterschied, ob man auf dem Land oder in der Stadt aufwächst? Da hat man ganz anderes um sich, was die Phantasie anregt.
Ja, schon. Die Natur spielt eine viel größere Rolle. Wir waren als Kinder ja immer draußen. Die Wohnung meiner Tante war so winzig, meine Tante hat uns immer rausgeschickt. Sie hat gesagt: Raus, raus, ich brauche Platz. Wir sind dann immer weg, wir waren nie zu Hause, und wenn es geregnet hat, sind wir bei der Post untergestanden, bis es aufgehört hat.
Die Bagage“ – das war bei uns im Weinviertel eigentlich ein negativer Begriff. Wenn man sagte: „So eine Bagage“, war das nicht sehr nett gemeint.
Das ist auch negativ. Bei uns auch. Die Bagage, Gepäck ist ja auch nicht angenehm, ist schwer zu tragen, lästig. So ähnlich ist „die Bagage“: Die ist einfach nur lästig. Aber wir selber, unsere Bagage – wir haben immer eine sehr große Verbundenheit miteinander gehabt. Und wir waren auch stolz. Stolz worauf? Auf nichts. Stolz darauf, die Bagage zu sein.
Wer aber die eigentliche Bagage ist, stellt sich dann ja heraus.
Ja, genau. Nur hätten die anderen sich nie als Bagage bezeichnet. Aber wenn man von sich sagt: Wir sind die Bagage, wenn man es sich zu eigen gemacht hat, dann ist es schon wieder etwas Besonderes.
Und das waren Ihre Leute ja auch: etwas Besonderes.
Ja, ich glaube schon. Oder wir waren einfach anders als die anderen. Das hat uns zu etwas Besonderem gemacht.
Wie wichtig ist die eigene Herkunft? Wie sehr prägt einen die? Wie sehr hat Sie das geprägt?
Es ist wahnsinnig wichtig. Ich hätte nicht im Traum gedacht, dass ich je so viel Erfolg haben würde in meinem Leben. Aber was ich jetzt bei diesem Buch gemerkt habe, wenn ich mit Leuten rede: Viele, die dieses Buch lesen, werden an ihre eigene Bagage oder an ihre eigene Vergangenheit erinnert. Ich glaube, das macht den Reiz. Sie lesen eine fremde Geschichte und haben zum Glück ihre eigene vor sich. Das habe ich jetzt oft gehört.
Wie wichtig ist das Erinnern?
Das ist auch total wichtig. Ich bin sowieso der absolute Familienmensch.
Obwohl Sie, wie Sie ja sagen, in keiner intakten Familie aufgewachsen sind?
Nein, überhaupt nicht, aber vielleicht darum.
Sie waren erst elf Jahre, als Ihre Mutter gestorben ist, und Sie wussten nicht, dass Sie sie verlieren würden. Meine Mutter war sehr krank, als ich elf war, und wir Kinder wussten auch nicht, ob oder wie ernst es war. Sie hat alles gut überstanden und ist heute 84. Aber beim Lesen Ihres Buchs dachte ich mir: Wie muss das für Sie gewesen sein?
Es ist einfach total grausam, wenn man als Kind die Mutter verliert. Und vor allem grausam ist, dass man nicht weiß, dass man sie verlieren wird. Wir wussten schon, dass sie krank war. Die Mutti war ja immer krank. Sie ist immer im Bett gelegen. Ich kenne sie nur im Bett. Sie hatte sowieso eine ganz vage Gesundheit, und dann hatte sie diesen Krebs, von dem man ein Stück nach dem anderen rausgeschnitten hat, immer hoffend, dass es dann gut ist. Es waren einfach alles schlechte Ärzte in Bludenz in einem Provinzspital, niemand hatte eine Ahnung. Es ist immer furchtbar. Aber wenn man es wüsste, dann könnte man sich vorbereiten oder man könnte wissen, wie es wird. Aber darüber zu sprechen – das war bei uns überhaupt kein Thema. Als die Mutti gestorben ist – dieses Bild habe ich so oft vor Augen: Ich kam aus dem Turnunterricht und kam in das Haus und samstags gab es immer das Gleiche bei uns, Rindfleisch und Salzkartoffeln, und dann habe ich gesehen, dass meine Tante weint, und meine Schwester hat immer den Kopf an die Wand geschlagen. Und ich habe gedacht: Was ist da los? Ich habe es dann aber irgendwie gewusst. Das war so schrecklich. Dieses Bild, das werde ich nie vergessen. Das ist so prägend. Damit lebt man dann eben.
Und mit Tante Kathe konnten Sie auch noch viel über die Familie sprechen?
Ja. Am Anfang hat sie immer gesagt: Ich sag dir gar nichts. Dann habe ich mir gedacht, ich warte und habe mich ein bisschen bei ihr eingeschmeichelt, und schon hat sie gesagt: O.k., ich erzähl dir ein bisschen. Und dann hat sie angefangen, ganz zaghaft, und endlich ist es mit ihr durchgegangen und sie hat erzählt und erzählt. Ich habe mir gedacht, die erfindet ja. Sie hat auch viel erfunden, glaube ich. Aber das kam mir so zupass, dass sie erfunden hat. Das war genau das, was ich brauchte. Und ich habe ihr nicht gesagt, dass ich ein Buch schreibe. Um Himmels willen, dann hätte sie mir nichts erzählt.
Ich könnte mir vorstellen, dass solche Sachen – wie Ihre Mutter, die von ihrem Vater ignoriert wird – sehr prägend sind und sich in der Familie fortsetzen.
Als ich „Die Bagage“ fertig hatte, dachte ich: So, jetzt muss ich über jeden noch etwas schreiben, damit es gerecht ist. Wenn ich über sie nachgedacht habe, dachte ich: Es ist so ungerecht. Die Kinder meiner Großmutter, meine Tanten und Onkel, haben kein gutes Leben gehabt. Und die hätten doch um Himmels willen ein gutes Leben verdient! Aber die haben alle kein gutes Leben gehabt. Wirtschaftlich sowieso, aber das würde ich jetzt gar nicht als tragisch bezeichnen. Aber viel Lieblosigkeit. Und nur Pech. Ich habe Angst, dass ich es fortsetze. Ich schaue immer auf meine Kinder und denke mir: Der und der hat sich selber gern, was ich wichtig finde, denn wir hatten überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich war so scheu, auch meine Schwestern. Mein Bruder weniger. Aber dieses mangelnde Selbstbewusstsein – das ist schon fatal. Alles scheue Leute. Am wenigsten die Paula. Die Paula war extrovertiert.
Sie schreiben ja auch so schön im Buch, wie das Wort „lebhaft“ auf Mädchen bezogen damals nichts Gutes bedeutete. Man durfte ja auch nicht zu laut sein.
Ja, genau. Meine Tante hat auch immer zu mir gesagt: Ja, ja, die Monika ist eine Politische. Auch wenn das mit Politik gar nichts zu tun hatte. Das hat einfach geheißen, sie ist schwierig.
Das Buch spannt einen Bogen von Ihrer Großmutter zu Ihrer Mutter und zu Ihrer Tochter Paula, die 2003 verunglückt ist. Und es wäre seltsam gewesen, wäre Paula nicht vorgekommen.
Es wäre nicht gegangen, das geht nicht.
Sie ist sehr präsent in Ihrem Leben.
Das wird man nicht glauben. Das ist auch irgendwie ein Glück für uns, dass Michael und ich es geschafft haben, dass die Paula immer bei uns am Tisch sitzt. Mir haben Leute erzählt, die Ehe geht auseinander, alles wird furchtbar. Und bei uns war es genau das Gegenteil. Wir sind so eng geworden durch diesen Verlust. Und weil die Paula immer da ist und wir haben auch ihr Bild am Tisch, es ist wirklich so, sie ist präsenter in unserem Sprechen, Erinnern als damals, als sie in Wien an der Filmakademie war. Da haben wir nicht so oft etwas von ihr gehört.
Sie haben im Buch auch dieses schöne Bild: Sie befinden sich neben Ihrer stummen Mutter, und auf der anderen Seite neben Ihnen steht Ihre Tochter Paula.
Ja, das ist ein gutes Bild für mich.
Und beide sind begleitend in Ihrem Leben.
Ja, ich habe auch so eine kindliche Vorstellung, dass die Paula jetzt im Himmel oben die Mutti besucht und vielleicht mit ihr Marmorkuchen isst. Es ist tröstend. Sie kann ja auch manchmal den Shakespeare besuchen, wenn sie Lust hat, ist ja alles oben.
In Paulas Buch „Maramba“ gibt es einen Satz, der mir immer in Erinnerung geblieben ist: Wenn man beginnt, zum Kaffee die Untertasse zu nehmen, ist das ein Beweis für sein eigenes Leben. Ich hielt das immer für ein vollkommen stimmiges und wunderschönes Bild für das Erwachsenwerden.
Das ist ein gutes Bild. Was so schön war bei der Paula, wenn sie geschrieben hat: Sie war überhaupt nicht affektiert. Das ist ja oft so bei jungen Leuten, wenn sie zu schreiben anfangen, dass sie ein bisschen affektiert oder extrem ich-bezogen sind. Das war sie überhaupt nicht.
Hilft das Schreiben? Sie sagten einmal, dass Sie nach dem Tod Ihrer Mutter begonnen haben, auf Notizzettel zu schreiben.
Man kann ja immer nur für sich sprechen. Mir hat es schon geholfen, weil das Schreiben ja ein Freund ist. Das Blatt Papier, auf dem ein Kind kritzelt, wenn man es gekränkt hat, ist dann ein Freund. Ich hatte kein Tagebuch, aber kleine Zettel, auf die ich alles raufgeschrieben habe. Ich hätte es ja niemandem erzählen können. Meine kleine Schwester hätte es nicht verstanden, und meine große Schwester hätte gesagt: Jetzt übertreib doch nicht immer alles so. Die ist völlig nüchtern. Sie ist ein unheimlich lieber Mensch, aber die kann damit nichts anfangen. So hatte ich die Zettel. Die haben mich gelassen, wie ich war.
Paula kommt immer wieder in Ihren Büchern vor. Hilft das?
Es hilft. Das muss ich wirklich sagen. Als ich „Bevor ich schlafen kann“ schrieb, habe ich mir gedacht: Jetzt kommt die Paula nicht vor. Sie kommt ja oft in meinen Geschichten vor, und ich dachte, die Leute denken, dass ich das irgendwie verwende. Dieser Gedanke wäre mir furchtbar unangenehm. Aber dann stand sie einfach da, und dann musste ich sie nehmen. Es ist notwendig, glaube ich fast.
Ist Schreiben für Sie lebensnotwendig?
Schon. Auf jeden Fall. Der Michael ist ja auch jemand, der schreiben muss. Er sagt immer, wenn ich nicht schreiben würde, dann wäre ich in der Klapsmühle. Wenn einer eine so überbordende Phantasie hat, muss er das anderen Leuten schenken. Es wäre sonst schade darum, oder?
„Die Bagage“ ist trotz der Coronakrise und des Ausfalls Ihrer Lesungen und Veranstaltungen ein enormer Erfolg und steht seit Monaten auf den Bestsellerlisten in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
Ja, es ist unheimlich. Aber ich habe immer das Gefühl, da steht jemand neben mir, und der hat das gemacht. Es ist ja auch ungewöhnlich, wenn man so spät Erfolg hat – ich bin 72 Jahre alt – , und darum ist es auch so ein Geschenk.
Haben Sie damit gerechnet?
Nie. Nicht im Traum. Ich habe mir gedacht, es wird so sein wie bei meinen anderen Büchern, die werden dann gelobt, aber sonst … Man schreibt ohnehin in erster Linie für sich. Aber wenn man fertig ist, hofft man natürlich, dass es ganz viele Leute lesen werden.
Aber es freut Sie, oder?
Es freut mich unglaublich. Ich muss mich manchmal in meine Hand zwicken. Wenn man Erfolg nicht gewohnt ist, dann ist es etwas ganz Besonderes. Wenn ganz junge Schriftsteller Erfolg haben, ist das ein riesiges Problem. Denn dann haben sie den Stress, das nächste Mal etwas gleich Gutes abzuliefern. Es kann ja auch wahnsinnig gut sein und trotzdem nicht gut ankommen. Man sollte mit Freude dabei sein.
Früher Erfolg hat leider schon oft viel zerstört.
Ich glaube es auch. Ich bin niemand, der übermütig wird, wenn er Erfolg hat. Das wäre ich auch früher nicht geworden. Aber für einen jungen Menschen ist es schon normal, bei Erfolg übermütig zu werden, oder?
War es gut, dass der große Erfolg ein bisschen später gekommen ist?
Das war sicher gut. Schreiben ist ja ein anderer Akt. Ich schreibe jeden Tag. Nach Paulas Tod hatte ich so ein Tief, da habe ich sicher drei Jahre nicht geschrieben. Als ich dann wieder angefangen habe, habe ich gesagt, ich kann es ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Man kommt schon rein, aber es ist immer wieder ein Neuanfang.
Ist das vielleicht auch etwas Schönes, dass es immer wieder ein Neuanfang ist?
Schon, schon. Ohne den Michael hätte ich es ohnehin nicht geschafft, weil er mich immer ermutigt hat und gesagt hat: Du schaffst es, du schaffst es!
Schriftsteller-Ehen sind ja nicht immer die einfachsten. Da gibt es Konkurrenzgedanken, einer fühlt sich vielleicht im Schatten des anderen. Bei Ihnen beiden aber hatte ich dieses Gefühl nie.
Die Leute glauben es uns nicht, aber es ist wirklich die Wahrheit. Es hat auch sicher damit zu tun, dass der Michael so ganz eigenständig ist. Er erzählt mir immer, dass er schon als Dreizehnjähriger so in sich, so verkapselt war. Haben Sie schon gehört, was er geschrieben hat? Mehr als 1000 Seiten. Er hat so schreckliche Angst, dass es zu lang ist. Aber ich würde mich so wahnsinnig freuen, wenn das auch so gut ankäme. Das hat er in drei Jahren geschrieben, und es ist unglaublich. Es ist ein philosophisches Buch und es heißt „Monsieur Katerchen“, weil es die Geschichte eines Katers ist, der die Weltgeschichte durchstreift. Der Kater kann lesen und schreiben. Und was verrückt ist: Er kann photographisch lesen. Er liest die „Anna Karenina“ in drei Minuten und hat das ganze Wissen in seinem Kopf. Das ist so spannend, das ist ein Wunder. Ich sage immer zu ihm, das wird ein Kultbuch. Das muss es werden. Die Tatsache, dass es die Geschichte eines Katers ist, macht das Buch so heiter. Wenn er sagt, er geht in sein Büro, muss man schon schmunzeln.
Sie sind ja auch die ersten Leser Ihrer jeweiligen Bücher? Beraten Sie einander auch?
Ja, auf jeden Fall. Michael geht alle meine Manuskripte durch und macht sie so schön, dass es kaum noch jemanden braucht, weil sie durchlektoriert sind, schon bevor sie der Verlag hat. Das ist ein gutes Gefühl. Er sagt es mir auch, wenn die Dramaturgie nicht stimmt. Das sagt mir der Lektor vielleicht auch, aber der kennt mich ja nicht.
Sagen Sie es ihm umgekehrt auch?
Ja, ich sag es ihm auf jeden Fall. Man muss ganz ehrlich sein, und das ist für den anderen auch hart. Manchmal sag ich, du, das ist überbordend. Dann ist er beleidigt und sagt zu mir: Wieso verknappst du so extrem, keiner kennt sich aus. Dann ist man wahnsinnig beleidigt, aber man weiß ganz genau, der andere hat recht, meistens.
Rund um mich sehe ich fast nur scheiternde Beziehungen. Ihr Mann und Sie sind schon so lange beieinander. Und, Sie haben es ja erwähnt, viele Beziehungen überstehen den Verlust eines Kindes nicht.
Ja, ich glaube auch, dass das kritisch ist. Das ist immer eine Nahtstelle, wo es brechen, aufgehen könnte. Und da, das haben wir irgendwie geschafft. Und dann ist es auch eine Sache des Vertrauens. Wenn man jemanden liebt – das verändert sich natürlich mit der Zeit extrem, einmal ist es so, dann so –, ist Vertrauen dabei. Wenn Michael etwas zustoßen würde – ich denk mir, ich möchte keine Stunde mehr leben. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Irgendwann ist man ja fast eine Symbiose.
Vertrauen, Liebe, Respekt, Freundschaft – das alles gehört zu einer guten Beziehung, würden Sie sagen?
Auf jeden Fall, alles, ja. Das klingt jetzt so heile-Welt-mäßig. Ist es natürlich nicht. Es gibt in jeder Beziehung Auf und Abs. Aber gerade das gemeinsame Durchstehen und dann wieder Eintauchen – das gehört ja auch dazu. Immer einer Meinung sein – das wäre ja nicht normal. Das wäre langweilig.
Ja, und fast verdächtig, denn dann lebt man vermutlich nebeneinander her und hat einander nicht mehr viel zu sagen.
Verdächtig, ja. Manche Beziehungen halten auch nur wegen der anderen Leute. Am Land ganz besonders. Das ist immer noch so.
Am Ende der „Bagage“ adressieren Sie nochmals Ihre Tochter Paula. „Beinahe alle“, heißt es da, „über die ich schreibe, liegen unter der Erde. Selber bin ich alt“. Glauben Sie an so etwas wie ein Leben nach dem Tod?
Ich will es glauben. Ich will es glauben. Wenn ich dann mit den vielen Atheisten, die wir kennen, zusammenkomme, komme ich mir immer so kindisch vor, und dann geniere ich mich. Man will ja nicht über den lieben Gott reden, aber ich glaube, ja. Mir ist schon viel geholfen worden, das muss ich wirklich sagen.
Inwiefern?
Bei der Paula, und bei allen Schwierigkeiten, auch wenn meine Kinder jetzt Probleme haben. Es gibt ja immer wieder Situationen, die schrecklich sind. Einmal hat uns der Lorenz aus Wien angerufen und gesagt, dass er gerade zusammengeschlagen worden ist und man ihn ins Krankenhaus bringt. Was macht man da ohne den lieben Gott? Da dreht man ja durch. Das ist ein Alptraum. Man muss sich an etwas festhalten können.
Glauben Sie, dass Sie Ihre Tochter einmal wiedersehen werden?
Ja, bin ich sicher. Das tröstet mich so sehr, dass ich gar nicht anders denken will. Der Michael freut sich ja auch schon darauf.
In Ihren berührenden Kurzgeschichten haben Sie Menschen aus Randgruppen eine Stimme gegeben. Über der Corona-Berichterstattung aber scheint man die Situation der Flüchtlinge vollkommen vergessen zu haben. Auf Lesbos hinderten Anrainer Flüchtlinge, darunter Kinder, am Anlegen. Mir fehlte hier der Aufschrei. Was sagen Sie dazu?
Als ob sie nicht mehr da gewesen wären. Ja, das ist das Schlimme: Man behandelt das eine und vergisst das andere. Es darf keine Gleichzeitigkeit mehr geben. Ein Unglück genügt. Besonders, wenn es uns betrifft. Dann ist es so groß, dass, bitteschön, alles andere weg sein muss. Noch dazu, wenn es von außen kommt. Ich habe mir auch gedacht: Diese armen Leute, die beengt leben, die viele Kinder haben in einer kleinen Wohnung, und der Mann hat den Job verloren. Die streiten, die bringen sich fast um, die kämpfen ums Geld – was ist das für ein Leben? Da geniert man sich, wenn es einem so gut geht. Und die haben ja nach wie vor nichts. Bei uns kommt immer eine alte Frau und holt das Obst, die Sachen, die am Tag nicht verkauft werden, und schaut, dass sie sie noch einmal verkaufen kann. Weil sie nicht mit leeren Händen kommen will. Und um das Ganze noch besser zu machen, sagt sie immer, dass die Sachen aus der Schweiz sind. Dadurch werden sie noch ein bisschen veredelt. Aber sie geht los und schaut, dass sie die Sachen für wenig Geld anbringt – das beeindruckt mich. Gott sei Dank gibt man ihr das Essen. Beim Spar gibt man es ihr. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch machen. Aber beim Hofer haben sie in die Container dann Spülmittel reingeschüttet, damit es niemand mehr essen kann. Und das ist der Ausbund an Gemeinheit.
Welche Verantwortung hat man als Autor, als Autorin in einer Welt, die trotz der historischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts unentwegt ausgrenzt und ausschließt?
Ich finde schon, dass ich eine Verantwortung habe als Schriftsteller. Ich bin auch politisch, aber nie so sehr wie der Michael. Der macht das anders als ich. In seiner Literatur wird das anders behandelt. Ich muss es so schreiben, wie ich es tue. Der Michael kann eine Rede halten, die viele Leute berührt. Das könnte ich gar nicht. Aber die Leute, die ich sehe, wenn ich aus dem Haus gehe, die nichts haben, junge Leute, die irgendwo herumhängen –, das kann ich ja nicht vergessen. Aber manche Leute sind wie Jogger. Sie schauen nicht nach rechts und nicht nach links. Ich bin keine Joggerin, ich gehe spazieren. Aber da sehe ich, dass der Baum, der gestern noch so war, heute anders ist. Und bei den Menschen ist es auch so.
Fühlen Sie sich den Frauen in Ihrer Familie nach Ihrem Roman „Die Bagage“ noch mehr verbunden?
Ja, schon. In meiner Generation waren die Frauen zusammen, und die Männer waren eine Clique. Die Männer philosophierten und politisierten im Wohnzimmer. Und die Frauen setzten sich in die Küche und redeten und unterhielten sich über Strickmuster und Kochrezepte. So war das bei meinen Onkeln. Die Frauen waren natürlich auch klug. Aber sie haben eine andere Art zu sprechen. Wenn sie über Ungereimtheiten reden, dann sagen sie vielleicht: Der Frau so und so geht es so schlecht, die war jetzt mit dem Rollator unterwegs, hat die jemand, der sich um sie kümmert? Das ist ja auch ein soziales Reden.
Auch während des Lockdowns waren es großteils die Frauen, die für die Aufrechterhaltung des Alltags und für das Funktionieren des Homeschooling gesorgt haben. Danach durften sie wieder unbedankt in ihre schlechter bezahlten Jobs zurückkehren.
Ja, es ist erschreckend. Es ist immer so, dass große Löcher in der Gerechtigkeit sind.
Ist das Dorf ein Mikrokomos der Gefühle, der Emotionen?
Ja, das würde ich sagen.
Wo fühlen Sie sich zuhause?
Wenn ich in Wien bin, bin ich auch glücklich. Aber ich bin leider kein geselliger Mensch. Ich finde es total schön in Wien, aber ich fahre immer wieder so gern heim, nach Hohenems.
War es beruhigend, wichtig, auf die eigene Vergangenheit, die Ihrer Familie zurückzuschauen?
Es war sehr tröstend für mich. Ich habe es auch total gern gemacht. Ich habe jetzt seit der Coronazeit geschrieben wie eine Verrückte, und gleich mein zweites Buch geschrieben, das nur von meinem Vater handelt.
Wie war denn das Verhältnis zu Ihrem Vater?
Ich würde sagen, es war fast nicht da. Mein Vater war erstens bücherverrückt. Er hat die Bücher viel lieber gehabt als uns Kinder. Er hat auch immer heimlich Bücher gekauft. Er hat dann nochmals geheiratet, und meine Stiefmutter durfte nicht wissen, dass er Bücher kauft, weil kein Geld für den Haushalt da war. Er hat die Bücher dann im Kohlenkeller versteckt. Er hat immer wie ein Verrückter gelesen. Er ist immer in seinem Stuhl im Wohnzimmer gesessen und hat gelesen. Es war ihm völlig egal, wie viel Kinder da herumgekrochen sind. Seine zweite Frau und er hatten dann auch noch zwei Kinder, und dann waren wir vier noch da, und immer noch andere Kinder. Das hat ihn überhaupt nicht gestört beim Lesen. Er hat mit den Kindern nicht geredet, er hat auch mit uns wenig geredet. Als die Mutti noch gelebt hat, war seine Beziehung zu ihr sehr intensiv. Er hat sich unheimlich viel um sie gekümmert. Er hat ihr auch immer vorgelesen. Die waren ein Liebespaar, zu dem die Kinder fast keinen Zugang hatten. Und als sie starb, ist er, muss ich sagen, verrückt geworden. Er war nicht mehr lebensfähig. Er konnte nicht mehr arbeiten. Man hat ihn dann in sein Heim gebracht. Dann hat man ihm ein Kabuff zur Verfügung gestellt, wo er seine Bücher hatte, und ließ ihn in Ruhe. Er konnte dort essen und schlafen. Da war er ein paar Jahre. Dann haben meine Onkel, die Bagage beschlossen, auch weil es eine Zumutung für meine Tante Kathe war, noch diese drei Fratzen zu nehmen, dass man ihm eine Frau zuführen muss. Mein Vater wollte gar keine Frau. Er hat uns auch nie besucht, er war einfach nicht mehr da für uns. Aber er war einfach krank. Und dann hat man sich umgeschaut: Wie geht das, jemandem eine Frau zuführen? Wer könnte da in Frage kommen? Das macht einen großen Teil meines Buchs aus. Eine Cousine meiner Mutter war Schneiderin in der Schweiz und sehr erfolgreich dort. Die war schon ein bisschen mondän. Und dann hat man sich auf die geeinigt. Das war wirklich wahr: Die haben sie fast genötigt. Sie hat zuerst gesagt, sie will nicht, sie will selbstständig sein und einmal selber eine Schneiderei aufmachen. Dann hat ihr ihre Mutti so ein schlechtes Gewissen gemacht, dass sie meinen Vater geheiratet hat. Und uns vier Fratzen dazu. Das muss man sich einmal vorstellen.
Wann wird das neue Buch denn erscheinen?
Es ist schon fertig. Es wird im Frühling herauskommen. Es ist immer eine Gefahr, wenn man von den eigenen Leuten schreibt, dass man so drinhängt. Aber es ist auch eine besondere Geschichte: diese Suche nach einer neuen Frau.
Ist das Buch vielleicht eine kleine Aussöhnung mit Ihrem Vater?
Ich muss mich mit meinem Vater nicht aussöhnen. Ich war nie mit ihm im Clinch. Aber es ist eine schöne Erinnerung.
Ihr Mann hat mir einmal erzählt, dass die ersten Jahre finanziell nicht immer leicht waren?
Nein, die waren nicht einfach. Aber wir sind beide nicht verwöhnt. Michael genauso wenig wie ich. Ich bin immer stolz, wenn ich merke, mit wie wenig Geld man auskommt. Jetzt leben wir da in Saus und Braus, wir kaufen uns das Essen, das uns schmeckt. Es ist fast das Gegenteil. Wir haben ja alles. Aber die Kinder – die haben so wenig Geld gebraucht, auch, weil von uns ja nichts da war. Aber ich habe mir gedacht, das ist doch unglaublich. Da war ich ganz stolz. Wir haben mit fast nichts gelebt.
Das dachte ich mir auch manchmal während des Lockdowns. Wenn es irgendetwas Positives daran gibt, dann vielleicht das: Dass man sich bewusst wird, wie wenig man eigentlich zum Leben braucht und dass es auf anderes ankommt.
Ja, wobei es immer schwierig ist, sich etwas abzugewöhnen. Es ist leicht, sich etwas anzugewöhnen. Das ist schon ein großer Unterschied. Darum sind auch unsere Kinder so gut geworden: Sie hielten nie etwas für selbstverständlich.
Trotzdem wollten Sie nie etwas anderes machen als schreiben?
Ich habe immer geschrieben, außer in der Zeit, wo es uns schlecht ging wegen Paula. Die Kinder waren sicher der Grund, warum ich angefangen habe, so knapp zu schreiben. Aber nicht nur. Ich kann auch nicht episch schreiben. Dann habe ich immer so ein bisschen heimlich geschrieben, so wie wenn man verstohlen etwas macht und dann hofft, es ist bereit. Bücher zu schreiben und das dann am Abend in die Schreibmaschine zu tippen – wir hatten ja beide noch keinen Computer –, das hatte schon was.
Junge Autoren und Autorinnen können heute vom Schreiben alleine kaum leben. Viele brauchen dann einen Zweitjob.
Ja, das ist auch hart. Unser Konto hat der Michael nur mit den Sagen gerettet. Es war so ein glücklicher Zufall, dass er das erzählt hat. Und plötzlich ist es abgegangen. Dann mussten wir uns erst daran gewöhnen, dass wir plötzlich viel mehr einkaufen könnten. Michael hat so ungern im Rundfunk gearbeitet, und er hat wirklich alles gemacht – irgendwann hat er mit einem Orthopäden ein Interview gemacht, lauter solche Sachen –, nur um Geld heimzubringen, das war schon hart. Aber ich habe diese Zeit in schöner Erinnerung. Meine Tochter Undine hat sich einmal eine Fliegerjacke gewünscht, und als sie sie dann nicht mehr getragen hat, hat sie der Michael angezogen. So etwas würde kein Mensch mehr machen.
Was wünschen Sie sich?
Ich für mich habe ohnehin alles. Ich habe Sofie, meine Enkelin, gefragt: Was wünschst Du Dir denn? Was würdest Du Dir wünschen? Da hat sie gesagt: Oma, ich hätte gern ein Pferd vom Opa – und dann auch noch den Weltfrieden. Das hat sie immer gehört. Aber natürlich wünscht man sich das.
—
Monika Helfer wurde 1947 in Au, Vorarlberg, geboren. Nach dem Tod der Mutter kam die Elfjährige zu ihrer Tante. 1977 erschien der Erstling „Eigentlich bin ich im Schnee geboren“. Es folgten Romane, Kinderbücher, Erzählungen und Theaterstücke. Zuletzt wurde sie mit dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet. Sie lebt mit ihrem Mann Michael Köhlmeier in Hohenems.

Monika Helfer, „Bevor ich schlafen kann“ (Deuticke), 224 S.
Monika Helfer, „Schau mich an, wenn ich mit dir rede!“ (Jung und Jung), 186 S.