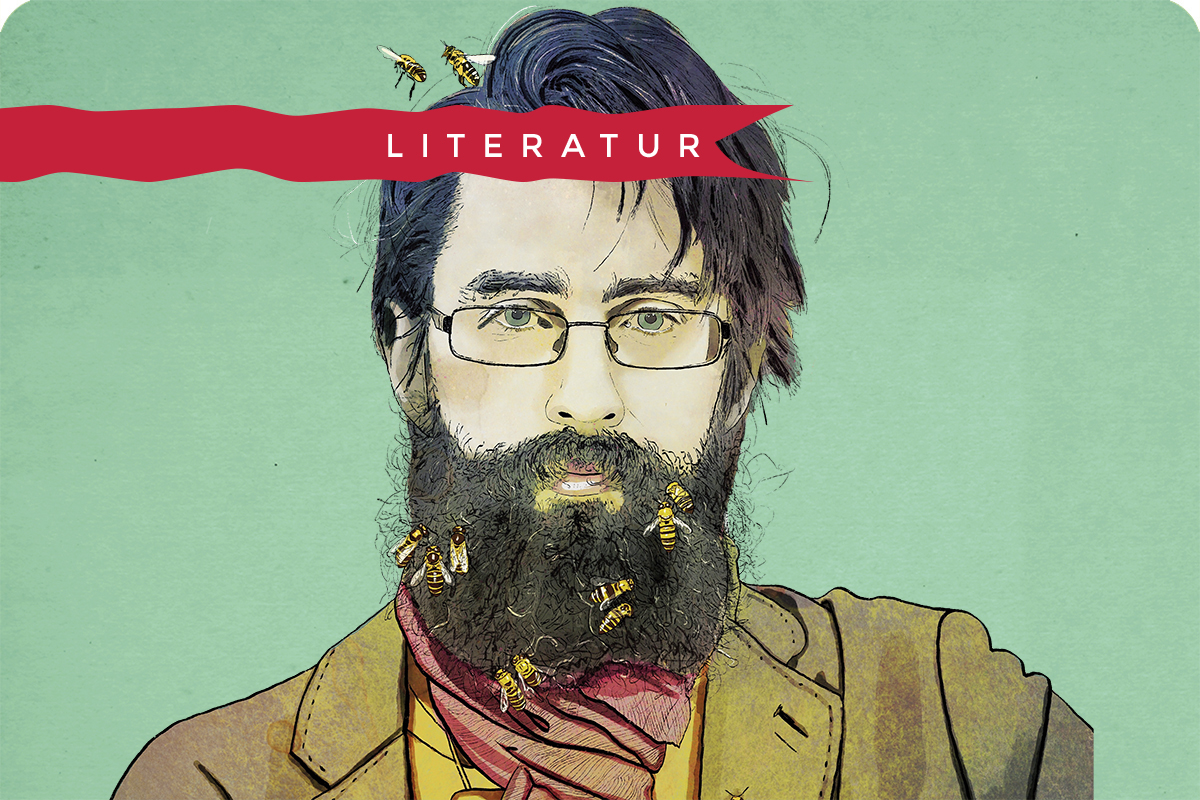Clemens Setz schreibt in »Die Bienen und das Unsichtbare« über die Sprache als Welterfahrung und stößt dabei zuverlässig über ihre Grenzen vor. Illustration: Jorghi Poll.
Sprache ist ein »unerhörtes Kunstwerk«, ein zweischneidiges Schwert und ein Zugang zur Welt – nicht zu einer einzigen universellen, sondern zu den vielen Welten der Sprechenden. Insbesondere in einer Zeit, in der Sprache gezielt zur Manipulation genutzt und als Spaltwerkzeug gebraucht wird, ist ein reflektierter Umgang mit Sprache unerlässlich. Zwar erleben wir diese Verzerrung und Dienstbarmachung von Sprache für politisch fragwürdige Zwecke nun wirklich nicht zum ersten Mal in der Geschichte, aber vielleicht fällt es uns Zeitgenoss/innen zum ersten Mal als ein Prozess auf, an dem wir selbst teilhaben. Insofern ist Setz’ neuestes Werk auch ein politisches, dessen unmittelbaren Bezug zum Jetzt man leicht entdecken kann, auch wenn er nicht intendiert gewesen sein mag. Wir haben nun womöglich Verständnis für manchen früheren Sprachenerfinder, dessen Ideal ein Zeichensystem der reinen Bedeutung war. »Pure meaning«, kein uneigentliches Sprechen, keine Ironie, keine Sprachbilder; das würde die Kommunikation der Menschen verbessern und vereinfachen. Es wäre fortan nicht nur unmöglich, Sprache zu instrumentalisieren, sondern auch, irgendetwas misszuverstehen. So jedenfalls u. a. die Überzeugung von Charles Bliss, Erfinder der sogenannten »Blisssymbolics«, die zwar in der Unterstützung von beeinträchtigten Menschen erfolgreich, aber als allgemein anerkannte Sprache gescheitert sind. Nicht nötig zu erwähnen, dass man der Freude an Sprache Wesentliches raubt, wenn alles eindeutig zu sein hat. Sprache ist weit mehr als Zeichen in regelhafter Anwendung, Sprache ist mehr als Bedeutung.
Clemens J. Setz, hinlänglich bekannter Kurator skurriler Geschichten und Erscheinungen, hat sich sechs Jahre lang auf die Spuren von Kunst- und Plansprachen begeben. Er hat Esperanto und Volapük gelernt, Blisssymbolics und Talossa untersucht und darüber nachgedacht, was Sprache und Poesie ausmacht. Wie funktionieren Sprachen? Worin unterscheiden sich die Schöpfer/innen verschiedener Sprachsysteme? Wachen sie dogmatisch über ihr Projekt oder legen sie die ganze Sache mehr als zeitloses Open-Source-Programm an, dem jeder nach Belieben Worte und Ausdrücke hinzufügen kann? Weshalb erfindet man überhaupt eine Sprache? Will man sie einfach nur erfunden haben oder soll sie auch gesprochen werden?
Wenn es nach dem Augenarzt Ludwik (alias: »Dr. Esperanto«) Zamenhof ginge, der 1887 seine »Lingvo Internacia« erfand, sollte seine Sprache gesprochen werden. Sie setzte sich bald unter seinem Spitznamen »Esperanto« durch und transportierte, ihrem Namen gerecht werdend, eine Hoffnung, eine politische Utopie. Esperanto sollte als Plansprache die internationale Kommunikation erleichtern und die Menschen miteinander verbinden. Dem verwirrenden Babel verschiedener Sprachen und Mundarten sollte das Esperanto gegenüberstehen, ein gemeinsamer Nenner überall auf der Welt. Und gemessen an anderen linguistischen Erfindungen hat es Esperanto zwar nicht zu einer weltweiten Verkehrssprache gebracht, immerhin aber zu einer regen Community, aus deren Reihen z. B. ein Dichter wie William Auld hervorgegangen ist. Bereits 2018 widmete Setz dem Esperanto-Poeten im Wunderhorn Verlag einen schmalen Band ausgewählter Lyrik (»Ein Meister der alten Weltsprache«). Tatsächlich brachte es Auld nicht nur zur Esperanto-Meisterschaft, sondern gar zu einer dreimaligen Nobelpreisnominierung. Das soll ihm erst mal einer nachmachen.
Clemens J. Setz nähert sich in »Die Bienen und das Unsichtbare« behutsam und mit einer lebhaften Neugier den verschiedenen Sprachschöpfungen. Sein Verhältnis zur Sprache ist ein Spielerisches, Tänzelndes, Experimentierfreudiges. Nicht nur im Umgang mit der Muttersprache, wie seine eigenen Texte immer wieder unter Beweis stellen, sondern auch in Kontakt mit erfundenen Sprachen und ihren eingekapselten Vorstellungswelten. Setz ist ein Suchender, der mit jeweils Sprachkundigen spricht, so es sie noch gibt: zum Beispiel mit Mustafa Ahmed Jama, der seine Gedichte aufgrund einer schweren Zerebralparese in Blisssymbolics schreibt. Einen Sommer lang versucht Setz sich an Volapük, erfunden 1897 von einem katholischen Pfarrer, der sich von Gott beauftragt sah, eine Weltsprache zu erfinden. »Cifal« (meinend: Oberstvorstand der Weltsprache zu Konstanz) des Volapük ist heute Hermann Philipps, der eine Lerngruppe auf Facebook betreut.
Setz wäre nicht Setz, wenn sein Erzählen nicht wucherte, wenn es nicht assoziativ wäre und anekdotisch, immer wieder ausbrechend aus dem Rahmen eines bloßen Sachbuchs über Sprachenschabernack. Mal erzählt er romanhaft die Geschichte einiger Protagonist/innen der untersuchten Sprachen nach, dann montiert er Tagebucheinträge aus dem Volapük-Sommer hinein, die von einer stetigen Entfremdung zwischen ihm und der Welt erzählen. Setz ist nicht allein als Lehrender anwesend, er begibt sich selbst als Lernender hinein in die Recherchen und zaubert dabei allerlei Kurioses aus dem Hut.
»Das Rückverzaubern des alltäglich Bekannten im Gebilde von geradezu außerirdischer Leuchtkraft ist eine der ersten und unersetzlichsten Funktionen der Poesie.«
Clemens Setz
Etwa, dass das volapük’sche Wort für Taschengeld »pokamon« lautet. Dass Elisabeth Mann Borgese ihrem Hund das Schreibmaschinenschreiben beibrachte und das Werk des Tiers gar veröffentlicht wurde. Dass ein 14-Jähriger in Milwaukee 1979 die Mikronation Talossa (samt eigener Sprache) erfand, um deren Regierung einige Jahrzehnte später ein bizarrer Erbfolgekrieg entbrannte. Dass die Nobelpreisrede von Peter Handke simultan auf rein phonetischer Grundlage ins Englische übersetzt und damit behutsam von jeder Bedeutung entkleidet wurde – und wie viel Schönheit plötzlich in dieser Bedeutungslosigkeit liegt. Setz zitiert den amerikanischen Dichter Ron Silliman in Bezug auf ein traditionell indianisches Gedicht mit den Worten: »Die Abwesenheit äußerer Bezugspunkte wird als eine Abwesenheit von Bedeutung allgemein missverstanden.«
Eine ähnliche Erfahrung macht man unweigerlich bei dieser beeindruckenden Reise durch Spracherfindungen aller Art: Zunächst ist da Unverständnis, zerfallen Wörter zu sinnlosen Silben und Buchstaben, bemüht sich das Gehirn zwar redlich, Bedeutung hineinzulesen, scheitert aber daran. Stattdessen eröffnen sich andere Herangehensweisen und Perspektiven. Etwa die reine Lautsprache eines Gedichts, wie es fließt und klingt und vibriert. Oder, im Fall deutscher Nonsensdichtung, wie es aufräumt mit konventionellen Vorstellungen und Bildern. Sprache kann, wie es Setz in Bezug auf Joyce schreibt, eine »Trampolinfläche für all das ungeheure Neue« sein.
»Das Rückverzaubern des alltäglich Bekannten im Gebilde von geradezu außerirdischer Leuchtkraft ist eine der ersten und unersetzlichsten Funktionen der Poesie.« (S. 236) Setz zieht Jandl heran und H. C. Artmann, schließlich darf man ihn aber auch selbst zu diesen Rückverzauberern zählen, die mit Literatur den Blick auf das Alltägliche verändern. Intensive Setz-Lektüre verwandelt den Blick, nicht nur durch ihren hohen Anteil an skurrilen Entdeckungen, sondern auch durch eine synästhetisch angereicherte, assoziative Sprache. Vieles erscheint im Setz-Licht plötzlich anders, und obwohl er für manche Metaphern gern als manieriert gescholten wird, habe ich keinerlei Mühe mir vorzustellen, wie sich »ein eigenartiges Gefühl von schulfrei« wohl anzufühlen hat. Eine »krummbeinige Stimmung« ist mir sofort begreiflich. Das Setz-Universum scheint selbst immer einige Millimeter daneben zu sein, verschoben auf eine Art, die subtil, aber in allem spürbar ist.
In Setz’ letztem Erzählband »Der Trost runder Dinge« leidet etwa ein Vater an wiederkehrenden Panikattacken. Er versucht stetig aufs Neue, mit der ihm zur Verfügung stehenden Sprache der Familie sein Leiden begreiflich zu machen. Seine Angst sei, »als wäre sein Körper ein Flugzeug, das in Bodennähe durch eine dicht besiedelte Innenstadt fliegt und aufpassen muss, mit seinen Flügeln keine Gebäude oder Brückenpfeiler zu streifen.« Der Protagonist glaubt schließlich, ähnliche Symptome an seinem Sohn zu erkennen und ist, trotz aller väterlichen Besorgnis, fast unzulässig erleichtert. Plötzlich gibt es eine Brücke zwischen beiden, eine gemeinsame Sprache, eine Verbindung, die einem anderen seine Welt erklärlich macht. Am Ende stellt sich heraus, dass die Beklemmungen seines Sohnes nicht auf ein gleiches Erleben zurückgehen. Nach Einnahme eines Mittels gegen Sodbrennen verschwinden die Symptome, während der Vater zurückbleibt mit seiner Welt, seiner Angst und seiner Sprache dafür. Darin stecken nicht nur eine setztypische autofiktionale Randnotiz – auch Setz wurden fälschlicherweise Panikattacken diagnostiziert, obwohl gastrointestinale Probleme ursächlich für die Beklemmungen waren –, sondern auch ein Bild für die niederschmetternde Inkompatibilität zweier Welten. Das Wittgenstein’sche Diktum von den Grenzen der Sprache als Grenzen der Welt wird bei Setz zwar erfahrbar – etwa dort, wo Kinder und Erwachsene mit Beeinträchtigungen nicht ausdrücken können, wie sie die Welt erleben, obwohl sie sie sehr wohl wahrnehmen, sehr zur Überraschung ihrer Umwelt –, aber nie verabsolutiert. Setz schreibt etwa von Glossolalie oder dem Sprachzerfall psychotischer Patient/innen nicht als hoffnungsloses Verlorengehen in der Welt, sondern als veränderte Form des Ausdrucks. Selbst dort, wo Grenzen etwa in Form von Reglementierungen sichtbar sind, darf man sie überschreiten, darf und muss man die Regeln brechen, um in ungeahnten Nischen Schönheit aufzuspüren. Bei Setz ist das oft eine Schönheit, die einige Qualität aus der Überraschung bezieht. Seine Komposita, seine Neologismen, seine Perspektiven sind nicht schön, weil sie etwas Bekanntes auf erwartbare Weise spiegeln, sondern weil sie das Bekannte zerbrechen und neu zusammensetzen.

Ein Baum vor der setz’schen Wohnung erinnert daran, »dass man jederzeit, vollkommen ohne Vorwarnung, aus der bekannten Welt und ihren geordneten Verhältnissen kippen kann, während man zum Teil, etwa der äußeren Form nach, noch in der alten Ordnung stehenbleibt (…)«. Setz-Texte sind gleichsam immerwährende Vorwarnung, eine Ahnung des Kippens und Schaukelns ins Düstere, Abseitige, Groteske. Man kann das natürlich als eine Sammlung obskurer Dinge in der Welt begreifen, als Spielerei mit Dichterklischees und Genie-Zuschreibungen, die Clemens Setz von Beginn seiner schriftstellerischen Karriere an begleiten. Das Geraune vom Wunderkind mag auch von Alters wegen nachgelassen haben – als er 2007 25-jährig seinen Debütroman »Söhne und Planeten« veröffentlichte, war es noch weit vernehmlicher zu hören.
Es gibt im Setz-Kosmos wiederkehrende Motive und Herangehensweisen, die von Beginn an die Texte prägen. Etwa ein starker Hang zum autofiktionalen Erzählen, das Setz nicht nur Erzähler, sondern immer gleichzeitig erzählte Figur sein lässt. Manchmal ganz offensichtlich wie etwa in »Indigo«, manchmal eher als Alter Ego in »Die Frequenzen«. Sein Erzählen ist auch strukturell eine ständige Grenzüberschreitung. Es verwebt Fakt mit Fiktion, Hochkultur mit Popkultur, bis ein ganz eigenes Gewebe entsteht, das sich bewusst im Uneindeutigen beheimatet. Nicht umsonst hegt Setz eine innige Liebe zum Nonsens, sei er bewusst produziert oder zufällig aufgetreten. Vielleicht ist der zufällig in die bedeutungsgeladene Welt hineinplatzende Nonsens noch viel befreiender, wie ein Aufatmen zwischen all dieser beschwerlichen Sinnhaftigkeit. Was ist also Erzählen? Gibt es eine Grenze zwischen literarischem Erzählen und der alltäglichen Rede? Kann nicht alles Erzählung sein? Wolfgang Reichmann bezeichnete das Spannungsverhältnis zwischen Erfindung und Realität in Setz’ Texten (insbesondere »Indigo« mit seinen exzessiv eingesetzten fiktiven Quellen)einmal als den »Haarscharf-Daneben-Effekt«.
Clemens Setz ist ein moderner, ein intertextueller Autor, für den auch soziale Medien selbstverständlicher Schauplatz und Katalysator literarischen Schreibens sind. Er dichtet regelmäßig auf Twitter, »der einzigen praktikablen und flächendeckenden augmented reality, die wir momentan besitzen«. Ihm sind Videospiele Anlass für Essays, sein Schreiben ist offen für sämtliche Einflüsse, elastisch, spielfreudig. In einem Interview zu seinem 2009 erschienenen Roman »Die Frequenzen« sagt er auf der Leipziger Buchmesse: »Normalerweise werden Geschichten so erzählt, chronologisch oder irgendwie linear, zuerst passiert das und dann das und das hatte diese Bedeutung […] und später kam es deswegen dazu. Im Grunde ist unser Leben ja überhaupt nicht so. Es ist ja immer irgendwie alles gleichzeitig da.« Und so ist es auch, wenn Setz schreibt. Es ist immer alles gleichzeitig da, ein Wildwuchs erzählerischer Welterfahrung, im Fall von »Die Bienen und das Unsichtbare« ist es nahezu eine Expedition in unwegsames Gelände, ein ziemlich kompakter Wochenendtrip vielleicht. Es gibt viel zu sehen, zu erfahren, nicht zu verstehen. Und die Bienen? Nicht nur versteckte ein Esperantist während der politischen Verfolgung in 20. Jahrhundert seine Manuskripte in einem Bienenstock, auch Rainer Maria Rilke schrieb an seinen polnischen Übersetzer Witold Hulewicz: »Wir sind die Bienen des Unsichtbaren.« Was das Unsichtbare ist? Setz bringt selbst die erfundene Sprache und ihre unbekannte Quelle ins Spiel, »wer eine erst vor kurzem erfundene Sprache spricht, macht sich in gewisser Weise vor der Weltgeschichte unsichtbar«. Aber auch sonst sammeln Literat/innen Nektar und Pollen aus diversen Erfahrungsquellen, um sie schließlich zu Vers und Text zu verdichten. Mit Glück steht am Ende etwas, das süß. ist und ein »Beinahe-Beweis für das Zauberkundige im Menschen«. Bei Clemens Setz hat man dieses Glück.
Clemens Setz, * 1982 in Graz. Er wurde mehrmals für den Deutschen Buchpreis nominiert und erhielt für seinen Erzählband »Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes« den Preis der Leipziger Buchmesse.
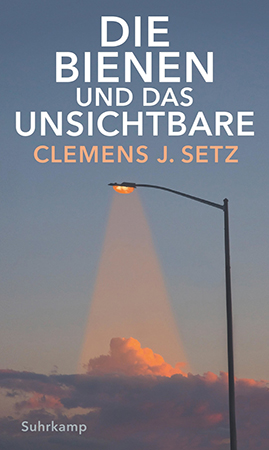
Clemens J. Setz
Die Bienen und das Unsichtbare
Suhrkamp, 300 S.