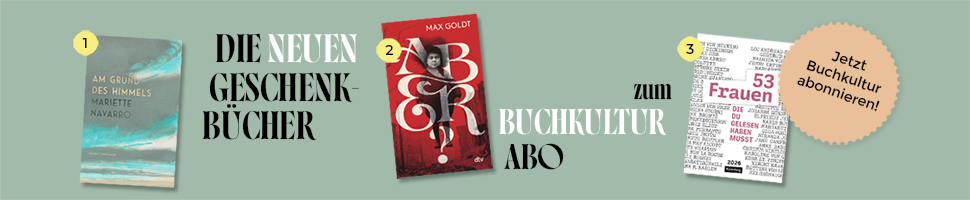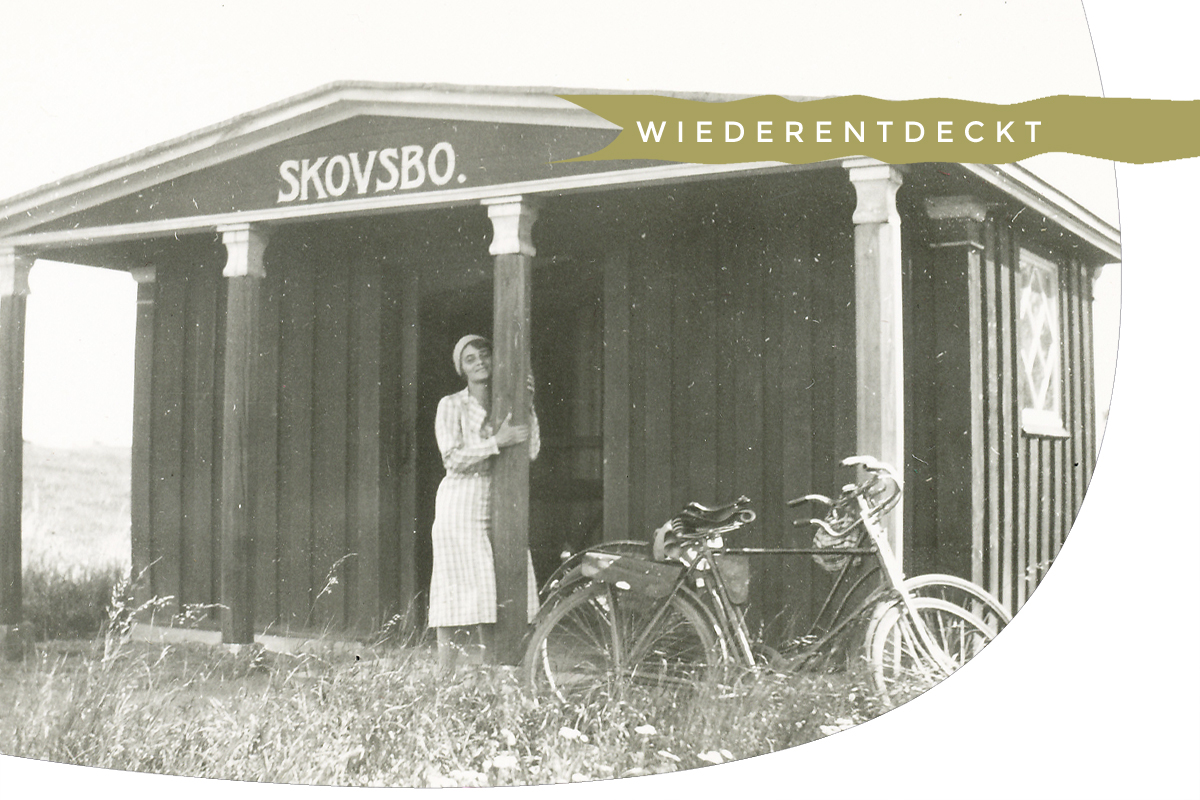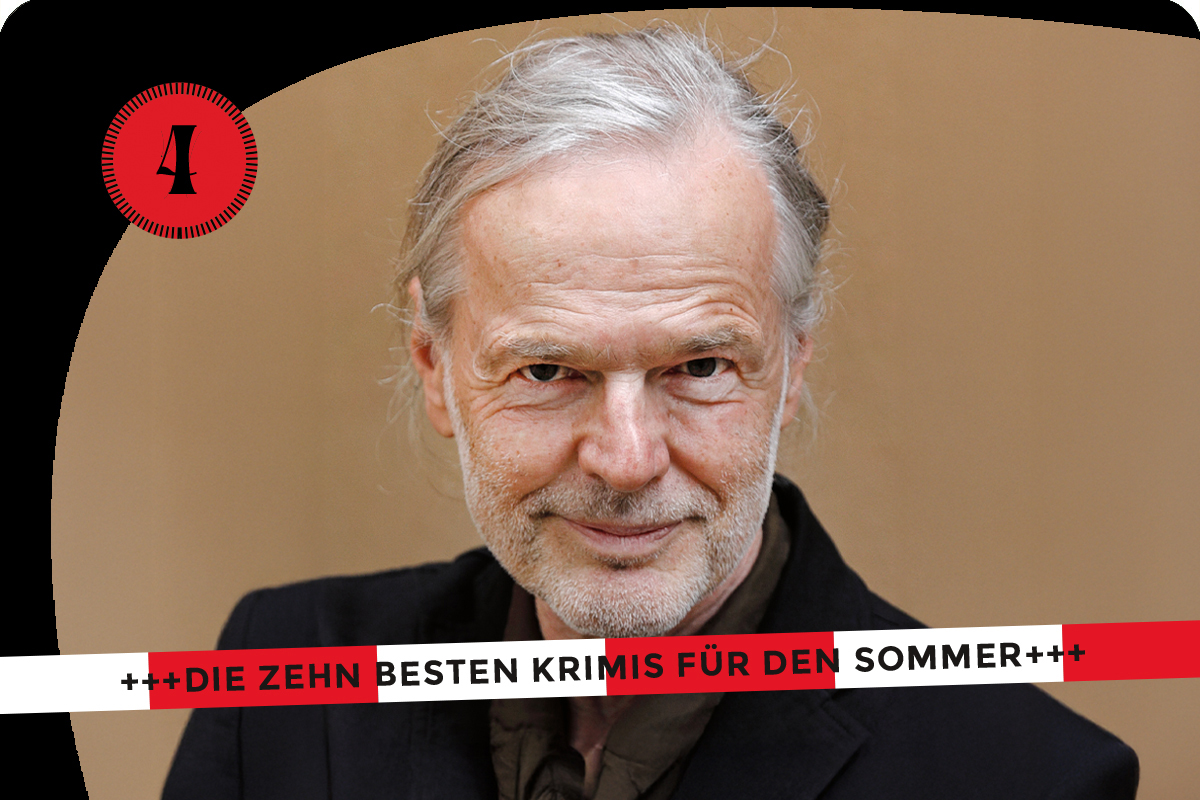Warum häufen die Menschen der Konsumgesellschaft so viele Dinge an, die das Leben dann doch gar nicht bereichern? Und wie wird das moderne Leben dadurch geprägt? Gabriel Yoran, Autor von »Die Verkrempelung der Welt«, hat uns dazu Auskunft gegeben. Foto: Jamil Yassine
Buchkultur: Herr Yoran, Krempel – was ist das eigentlich?
Gabriel Yoran: Ich meine mit Krempel Dinge, die schlechter sind, als sie sein könnten. Der Krempel, mit dem ich mich in meinem Buch befasse, nimmt sich wahnsinnig wichtig. Einerseits ästhetisch, andererseits hat es etwas, das ich Befassungsbedürfnis nenne, und zwar im doppelten Wortsinn: Diese Dinge wollen einerseits, dass man sich mit ihnen befasst, andererseits wollen sie angefasst werden. Sie arbeiten oft mit Touchscreens und berührungsempfindlichen Flächen, meistens ohne guten Grund. Krempel sind Dinge, die man eigentlich schon aufgegeben hat. Man hat schon durchschaut, dass sie nicht gut sind. Aber man ist immer noch von ihnen umgeben, hat sie noch nicht weggeworfen. So ist es auch mit dem Krempel, den man auf dem Dachboden oder im Keller aufbewahrt. Diese Dinge sind eigentlich erledigt, wir wollen mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Aber aus irgendwelchen Gründen werfen wir sie nicht weg, hängen noch an ihnen, scheinen sie noch zu brauchen.
Sie schreiben in Ihrem Buch nicht nur über die verkrempelten Produkte, sondern auch über einen Warenfetischismus, der sich am Ende als reaktionäre Nostalgie erweist. Diese Fetischisierung gilt etwa für die ›guten alten‹ Dinge aus dem Warenhaus Manufactum oder für eine 30.000 Euro teure Massivholzküche. Sind die Verkrempelung von Massenwaren und der elitäre Materialismus hochpreisiger Produkte die zwei Seiten einer Medaille?
(lacht) Also wenn es zwei Seiten einer Medaille sind, dann hat diese sehr unterschiedlich große Seiten. Man darf nicht vergessen, dass das, was Manufactum macht, eine totale Nische ist. Das spielt wirtschaftlich im großen Ganzen eigentlich keine Rolle. Es spielt – oder spielte muss man eigentlich sagen – eine große Rolle in den Feuilletons. Die Geschäftsidee von Manufactum ist eine Reaktion, im eigentlichen Sinn des Wortes, auf den Frust schlechter Alltagswaren. Ich halte es aber für irregeleitet, wenn man glaubt, man könnte die Probleme, die wir mit schlechten industriell gefertigten Produkten haben, nur lösen, indem man zu so einer Ästhetik und Herstellungsweise – Handarbeit, kleine Betriebe, hohe Preise und so weiter – zurückgeht, wie sie in Manufakturen praktiziert wurden. Respekt für dieses Geschäftsmodell. Die Idee ist super als Einzelunternehmen. Aber strukturell ändert sie nichts. Ich befürchte vielmehr, dass sie den Blick auf die Möglichkeit verstellt, industriell sehr gute Dinge herzustellen. Diese Gegenüberstellung – hier das schlechte Industrieprodukt, dort das gute in Handarbeit hergestellte Produkt – gibt es in Wirklichkeit nicht. Es gibt schlechte Dinge, die in Handarbeit hergestellt werden, und es gibt gute Industrieprodukte. Mit meinem Buch möchte ich eine Debatte über letztere anstoßen. Nicht weil ich so ein wahnsinniger Fan von der Industrie bin, sondern weil ich glaube, dass nur mit einer guten Massenproduktion eine große Anzahl von Menschen den Komfort und Lebensqualitätsgewinn erreichen kann, der möglich ist. Ein sehr einfaches Beispiel ist die Waschmaschine. Niemand will eine in der Manufaktur hergestellte haben. Das könnte auch keiner bezahlen. Und niemand will auf eine verzichten. Wir wollen funktionierende Waschmaschinen, die möglichst wenig Strom und Wasser verbrauchen, leicht zu bedienen sind und uns nicht nerven. Dieses Paket ist heute erstaunlich schwer zu bekommen. Auf der einen Seite gibt es einen realen Fortschritt. Die Dinge werden nicht einfach schlechter, sondern in bestimmter Hinsicht besser. Oft sogar in Bezug auf ihre Primärfunktion, zum Beispiel braucht die Waschmaschine heute tatsächlich wesentlich weniger Energie, weil sie wesentlich weniger Wasser erhitzen muss, um die Wäsche genauso sauber zu waschen wie früher. Außerdem haben moderne Waschmaschinen kleinere, sehr viel kompaktere, leisere, besser zu steuernde Motoren als die alten Waschmaschinen. Das ist ein echter Fortschritt, der tatsächlich sinnvoll ist, weil er Energie spart und das Gewicht der Waschmaschine verringert. Gleichzeitig gibt es einen totalen Rückschritt, was die Bedienung der Maschinen angeht. Ich komme hier zurück zum Befassungsbedürfnis. Die Hersteller können es nicht ertragen, dass man sich mit ihren Produkten nicht beschäftigt. Die wollen, dass meine Waschmaschine in meiner Aufmerksamkeit eine große Rolle spielt. Touchscreens, farbige Displays, Animationen, Melodien, die gespielt werden, Verbindung mit dem Internet, Push-Nachrichten aufs Handy, all das löst überhaupt kein Problem, sondern schafft einen Haufen Probleme, die sich im Alltag akkumulieren. Meine aktuelle Waschmaschine ist zum Beispiel mit einer Mischung aus richtigen Knöpfchen und Touchfeldern ausgestattet. Und manche Bedienelemente sehen aus wie richtige Knöpfe, aber man kann sie nicht drücken, denn in Wirklichkeit sind sie Touchfelder, die nicht immer reagieren. Das ist per se eine unzuverlässige Technik. Ich kann nicht einfach den Knopf drücken und aus dem Zimmer gehen. Ich muss drücken und warten, ob es klappt. Wo man früher mechanische Controls hatte, also Schalter, Drehknöpfe, Knebel, Knäufe, versucht man diese heute einzusparen. Bewegliche Teile kosten Geld. Touchscreens sollen dem Käufer Zukunft vermitteln, sind aber in Wirklichkeit Sparmaßnahmen. Verschärft wird das Problem dadurch, dass richtige Displays und Touchscreens von irgendeiner Software angesteuert und gestaltet werden müssen. Dabei geht es um Fragen wie: Was sehe ich da? Wie bediene ich das? Wie ist die Informationsarchitektur gestaltet, also wie funktioniert etwa die Menüstruktur? Die Hersteller von Autos zum Beispiel sind aber primär keine Softwarefirmen, haben also keine Erfahrungen damit, wie man User-Interfaces gestaltet. Die machen das jedoch einfach trotzdem. Wenn Dinge nicht funktionieren, fragt man sich, warum? Das hat doch alles schon einmal funktioniert, das ist doch kein Fortschritt. Man merkt, dass alles versucht wird, um Fortschritt herbeizuzwingen, aber ohne dass man die Kundschaft gefragt hat, ob die das eigentlich will.
Ich habe lange gehadert, bis ich dieses Buch geschrieben habe. Das Problem der Verkrempelung habe ich oft verdrängt. Ich dachte: ›Das erledigt sich von selbst. Stell dich nicht so an, das stößt dir jetzt nur auf, weil es nicht mehr so ist, wie die Dinge waren, als du 20 warst. Jetzt jammere nicht, uns geht es doch so gut. Die Dinge ändern sich halt. Stell dich nicht so an.‹ Diesem Selbstgespräch wollte ich Platz einräumen. Ich wollte kein Jammerbuch schreiben, das einfach nur sagt: ›Früher war alles besser.‹ Das glaube ich auch nicht. Ich denke, eine Kritik wird eher gehört, wenn man die Dinge, die besser geworden sind, auch als solche würdigt. Wenn ich sagen würde, alles wird schlechter, würde das erstens nicht stimmen, und zweitens disqualifiziere ich mich damit als ein aufmerksamer Beobachter der Warenwelt. Wenn man aber ausformuliert, dass die Dinge gleichzeitig besser – meistens in ihrer Primärfunktion – und schlechter – meistens in ihrer Bedienung und Verarbeitung – werden, dann kann man mit Fug und Recht sagen: ›Nein, ich bin kein Jammerheini, der nicht damit zurecht kommt, dass sich die Dinge ändern, sondern ich kann hier sehr wohl differenzieren. Ja, ich kann Fortschritt erkennen und würdigen, wo er stattfindet. Aber ich kann auch Rückschritt erkennen und benennen.‹
Bei der Lektüre Ihres Buches, habe ich mich immer wieder gefragt: Ist das hier jetzt Kapitalismuskritik? Wird der Krempel als Warenfetisch kritisiert? Es gibt von dem amerikanischen Psychoanalytiker Robert J. Stoller den Satz: »Ein Fetisch ist eine Geschichte, die sich als Objekt maskiert.« Lässt sich dieser Satz für die verkrempelten Dinge umdrehen? Sind also verkrempelte Dinge Objekte, die sich als Geschichte maskieren und somit nur vortäuschen, wertvoll zu sein, eigentlich aber immer schon veralteter Müll sind, für den sich sehr bald niemand mehr interessiert?
Konsumkritik ist ein unerträgliches Genre. Das will niemand lesen. Wenn von Anfang an klar ist, hier spricht jemand, der überzeugter Antikapitalist ist, der trägt seine sozialistische, ideologische Brille, dann erreicht man, glaube ich, einen Großteil der Leser nicht. Außerdem bin ich selbst Unternehmer. Ich habe also eine Innenansicht des Kapitalismus, mit der eine stumpfe Kapitalismuskritik nicht mehr möglich ist. Denn die erklärt einfach nicht alles. Zumal wenn man auf andere Systeme schaut in Bezug auf Produktqualität. Ich bin nicht als Kapitalismuskritiker losgelaufen, sondern von den Produkten und meinem Wissen darüber ausgegangen, wie diese in die Welt kommen. Verbraucher werden mit Quatschstorys dazu verführt, eine Ausgabe zu tätigen. Diesen Zusammenhang hinterfrage ich am Ende meines Buches. Wohl wissend, dass das kaum jemand hören will. Denn es ist extrem unangenehm, sich mit der Frage zu befassen, ob die eigenen Bedürfnisse authentisch sind. Wer diese Frage vermeiden kann, vermeidet sie. Bei dieser Frage kommt leicht die Kritik der Bevormundung auf. Ich habe hier sehr mit mir gerungen, denn ich konsumiere auch gerne. Diesen Widerstreit wollte ich abbilden.
Sie schreiben: »Die Dinge des Alltags sind nicht egal, denn gute Dinge machen gute Dinge mit uns – und schlechte Dinge schlechte.« Sie fordern in Ihrem Buch zwar nicht den Sozialismus, hoffen aber doch darauf, dass in den guten Dingen eine soziale Utopie steckt.
Ja! Eine Utopie der schöneren Dinge für alle! Man soll nach vorne sehen und nicht denken: Es gibt sie noch die guten alten Dinge. Ein Satz, der auch im Buch hätte landen können, ist: ›Man hatte uns Bauhaus versprochen und wir haben IKEA bekommen.‹ Bauhaus ist ja leider in den Händen von Vitra gelandet und jetzt sind es sehr teure, exklusive Dinge. Warum ist das so gekommen? Das ist wirklich schade! Das hätte anders kommen können. Mein Kunstlehrer hat mit uns Industriedesign durchgenommen. Ich fand das super! Es ist hilfreich zu lernen, warum die Dinge des Alltags so sind, wie sie sind. Dass es Gründe dafür gibt. Wenn man das gelernt hat, dann erkennt man, wenn plötzlich grundlose oder widersinnige Dinge passieren.
Am Ende Ihres Buches fordern Sie einen ethisch-ökonomischen Diskurs über das Warenangebot. Wie kann man die Leute, die über Ethik nachdenken, mit denen, die über Ökonomie nachdenken, zusammenbringen? Wie könnte dieser Diskurs aussehen?
Ich habe eine geheime Superkraft. Ich kann sehr unangenehme Widersprüche aushalten. Ich kann gleichzeitig denken, wie toll Konsum ist und, wie unmöglich es ist, meinen Bedürfnissen nachzugeben, nur weil ich es kann. Diesen Konflikt haben viele Menschen. Hier ist der Populismus extrem erfolgreich. Es heißt immer, er gebe einfache Antworten. Das finde ich gar nicht. Populismus schlägt sich bei Konflikten einfach immer auf eine Seite. Das ist für viele Leute erleichternd. Wir leben in diesem Widerspruch, wir leben in einem System, das dem kategorischen Imperativ überhaupt nicht standhalten würde. Aber wir genießen das trotzdem. Um auf die Frage zurückzukommen: Interdisziplinarität wäre super, aber es braucht auch Introspektion. Man muss reflektieren, was man empfindet. Es braucht einen phänomenologischen Blick auf Konsumpsychologie. Die Freude über den lauten Verbrennermotor ist nicht vernünftig, sondern eine Gefühlssache. Diese auf komplett unterschiedliche Disziplinen verteilte Denkarten zusammenzubringen, vielleicht ist es das!
Zum Schluss eine Frage, auf die Sie vielleicht gar keine Antwort geben können: Das Cover Ihres Buches ist sehr schön: Sehr schlicht, ohne Bild, nur mit Schrift. Aber dafür glänzt es silbern schillernd. Man möchte es unbedingt anfassen, wenn man es irgendwo liegen sieht. Ist das ein Kommentar auf die Produktsorte, die ihr Buch darstellt?
Hierzu gibt es tatsächlich eine Backstory, die geht so: Mein Lektor hat mich irgendwann nach meiner Lieblingsfarbe für das Buchcover gefragt. Da kam mir die Idee, das Buch in matt oder glänzend silber zu gestalten, sodass das Cover den Look von gebürstetem Aluminium hat. In der Regel besteht dieser Look aus einer Haut, die über Plastik gezogen ist. Sie simuliert eine Hochwertigkeit, die oft nur Fassade ist. Denn was wie Aluminium aussieht, ist selbst in Wirklichkeit aus Plastik. Simulation hoch elf. Shining new object! Der neuste Schrei, der ganz schnell seinen Glanz verliert. Wir wollten, dass das Cover das Buch selbst ein wenig auf die Schippe nimmt.
Gabriel Yoran, geboren 1978 in Frankfurt am Main, gründete bereits im Alter von 18 Jahren sein erstes Unternehmen, studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UdK Berlin und promovierte über Spekulativen Realismus an der European Graduate School in Saas-Fee und Valletta. Als Autor veröffentlichte er bislang Bücher über Redewendungen, klassische Musik sowie Kulinarik und schreibt für MERKUR, TAZ, DIE ZEIT und KRAUTREPORTER.
—

Gabriel Yoran
Die Verkrempelung der Welt. Zum Stand der Dinge (des Alltags)
Suhrkamp, 185 Seiten