Ein Bostoner Jude in China: In seinem fulminanten Debütroman „Im Reich der Schuhe“ erzählt der jüdisch-amerikanische Autor Spencer Wise, 51, tragikomisch von den Missständen in der modernen Schuhindustrie, einer Liebe in China, einem schwierigen Vater-Sohn-Verhältnis und der unabdingbaren Suche nach sich selbst. Ein Interview über Familienbande, Fast Fashion, unsere Verantwortung als Konsumentinnen und Konsumenten, Identität, die überraschenden Gemeinsamkeiten zwischen jüdischer und chinesischer Kultur, Humor und Hoffnung. Foto: Molly Hamil.
Buchkultur: In Ihrem Roman geht es u.a. um Fragen der Identität und der Schuld. An einer der berührendsten Stellen denkt der Protagonist Alex über die Wurzeln seiner jüdisch-amerikanischen Familie nach und über die Rolle seines Vaters, der eine Schuhfabrik in China besitzt, die moralische Verpflichtung, die damit seiner Meinung nach einhergeht, und die ethischen Fragen, die das aufwirft, vor allem, wenn man selbst einem verfolgten Volk angehört: „Wie kannst du dich Jude nennen?“ Würden Sie das näher ausführen?
Spencer Wise: Sie sprechen ein paar wesentliche Inspirationen für meinen Roman an. Wie jeder weiß, wurden die Juden Jahrtausende lang verfolgt und um den ganzen Erdball gejagt. Ich interessierte mich daher immer dafür, wie meine Familie, vor allem mein Vater, sein Erbe mit seiner Beteiligung an einem gIobalen Produktionsgeschäft in Einklang brachte, die auf billige Arbeitskräfte zurückgreift. Was erschwerend hinzukommt: Mein Vater ist ein wirklich netter Kerl. An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass Fedor im Buch nicht mein Vater ist. Mein Vater besitzt keine Fabrik oder so in China. Aber als Konsumentinnen und Konsumenten sind wir alle Mitschuldige des Systems. Solange wir nicht auf unsere Sneakers, Sweatshirts, Computer, Kopfhörer, iPhones usw. verzichten wollen, haben wir kein Recht, die Unternehmen zu kritisieren, die uns mit diesen Gütern versorgen. Aus diesem Grund ist mein Buch Fiktion und kein wirtschaftliches Exposé. Weil es keine einfachen Antworten gibt. Es ist einfach zu sagen: „Übernimm Verantwortung!“ oder „Setz Dich für Deinen Mitmenschen ein!“. Das sind noble Gemeinplätze, die wir alle in der Sonntagsschule gehört haben. Aber ich bin nicht sicher, ob das nicht nur Klischees sind. Es ist nicht immer so einfach, das Richtige zu tun, und häufig schadet das „Richtige“ dir. Im Roman würde das Richtige Fedors eigener Familie schaden. Es ist eine fast unhaltbare Lage, in der er sich befindet. Das wollte ich anhand der Charaktere untersuchen. Wie helfen wir anderen? Sollen wir helfen? Ich nehme an, wir würden alle mit Ja antworten. Und dennoch scheint es uns die Welt des 20. und 21. Jahrhunderts schwer zu machen.
Ich möchte mich nicht aufs hohe Ross setzen, wenn es um den globalen Kapitalismus des freien Marktes geht. Ich bin kein Ökonom, und ich weiß oft nicht, wovon ich rede. Aber es scheint nicht so einfach zu sein, an diesen Werten oder ethischen Grundsätzen festzuhalten in einer Welt, in der es eine wachsende Kluft gibt zwischen Arm und Reich und es für die meisten überaus schwierig geworden ist, für ihre Familien zu sorgen und in Würde zu leben. Der Roman dramatisiert diese Probleme ohne konkrete Antworten zu präsentieren.
Nochmals: Sich mit diesen Problemen zu konfrontieren, ist schwierig, weil wir uns eingestehen müssen, dass wir mitschuldig sind an einem System, das Menschen ausbeutet und unterdrückt. Der Ökonom sagt vermutlich, dass das der natürliche Weg der Industrialisierung sei. Sicher, das mag stimmen. Ich weiß nur, dass es hart ist, in einer chinesischen Schuhfabrik zu arbeiten, und ich wollte darüber schreiben, wie die Manager die menschliche Seite des Geschäfts ignorieren müssen, um die Arbeit zu erledigen. Geld zu verdienen macht es notwendig, all die unschönen menschlichen Fragen und Probleme beiseitezuschieben, die man in einer Fabrikhalle sieht.
Wie wichtig ist Ihnen Ihre jüdische Identität, Ihr jüdisches „Vermächtnis“?
Das Jüdischsein bedeutet mir alles, obwohl ich von der Gemeinschaft insgesamt vermutlich für einen sehr schlechten Juden gehalten werde. Ich bin nicht religiös und ich stelle nervende Fragen. Ich habe versucht, diese Ambivalenz und Verwirrtheit in Alex` Charakter zu legen, als er versucht, seine eigene Identität zu suchen – unabhängig von seinem Vater. Das musste ich auch. Als ich aufwuchs, fühlte ich mich schuldig, weil ich das Schuhgeschäft meines Vaters nicht übernehmen wollte. Ich wäre ein schlechter Geschäftsmann – vor allem, weil ich weder addieren noch multiplizieren kann. Aber ich wollte auch meinen eigenen Weg finden. Mein Vater wollte nicht einmal, dass ich mich daran beteilige, weil das Geschäft so instabil ist. Das verstärkte meine Schuld noch. Er wollte, dass ich ein besseres Leben habe. Aber dadurch fühlte ich mich noch schlechter! Wie kann er es wagen, mich glücklich sehen zu wollen! Sie sehen: Als Jude kann man nicht gewinnen. Man ist immer in einer schwierigen Situation, wie man es auch dreht und wendet.
Konnten Sie je mit Ihrem Vater über die schwierigen Fragen sprechen, die Ihr Roman aufwirft?
Nein. Das ist der andere Grund, weshalb ich das Buch schrieb. Manchmal ist es zu schwierig, diese sehr persönlichen Gespräche zu führen. Ich entschied mich also, diesen Fragen und Problemen fiktiv nachzugehen. Aber Fedor und Alex haben eine ganz andere Art von Beziehung als mein Vater und ich. Mein Vater und ich sind uns nahe. Wir sprechen jeden Tag miteinander. Und er hat mich immer in allen meinen schrecklichen Entscheidungen unterstützt, die mich an den Bettelstab brachten, wie zum Beispiel Schriftsteller zu werden. Oder meinen Versuch, ein DJ zu werden, obwohl ich jede Nacht um 9 Uhr einschlief. Er ist nicht wie der Vater im Buch. Das ist hart für einige meiner Leser und Leserinnen, die wollen, dass der Roman autobiographisch ist, aber das ist er bedauerlicherweise nicht. Ich sollte auch erwähnen, dass ich 2014 zu Recherchezwecken nach China ging und in einer Schuhfabrik in Foshan arbeitete. Es war ein bisschen ein Undercover-Journalismus und eine Undercover-Recherche. Als ich auf meiner Buch-Tour darüber sprach, wurde ich unweigerlich immer von jemandem, der mit dem Buch vertraut war, gefragt, ob ich jemals eine Affäre mit einer chinesischen Fabrikarbeiterin hatte. Meine Frau saß für gewöhnlich auch in der ersten Reihe und winkte. Schließlich habe ich begonnen, das Publikum diesbezüglich anzulügen, weil ich dann mehr Bücher bei den Veranstaltungen verkaufte.
Ihr Roman ist auch eine Liebeserklärung an das Schusterhandwerk. Was fasziniert Sie daran? Was bedeutet(e) es Ihnen und Ihrer Familie?
Ich bewundere die Handwerkskunst, die Tradition und die Fertigkeit von Handwerkern der alten Schule wie es mein Vater und mein Großvater sind und waren. Mein Vater ist einer der alten Shoe Dogs, wie sie sich nennen. Einer der wenigen letzten Menschen, die nicht nur wissen, wie man Schuhe designt, sondern sie auch selbst herstellen. Mein Großvater konnte das natürlich auch. Sie liebten Schuhe. Wenn eine Frau ins Restaurant kam, starrten mein Vater und Großvater auf ihre Schuhe und flüsterten. Jeder dachte, sie wären pervers. Aber sie diskutierten über neue Stile oder Ideen. Für meine Schwester und mich war es eine Qual, weil sie immer in ihrer eigenen Welt waren. Aber sie präsentierten sich immer als nüchterne Geschäftsmänner und nicht als sensible Künstler. Es war also alles irgendwie seltsam und charmant. Und ich dachte, wenn ich etwas über Schuhe lerne, würde ich auch etwas über meinen Vater erfahren. Dass ich ihm auf eine Art nahe sein könnte, wie es mir im wirklichen Leben nicht möglich wäre. Für das Buch zu recherchieren und es zu schreiben war eine Möglichkeit, mich wie nie zuvor mit ihm und meinem Erbe zu verbinden. Mein Vater half mir viel bei der Recherche. Er war eine enorme Ressource und liebte es zu helfen.
Ihr Roman ist relevanter denn je. Kurz nach dem Tian‘anmen-Massaker 1989 wurden die internationalen Wirtschaftsbeziehungen mit China wiederaufgenommen. Wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, hängt die sogenannte westliche Welt stark von China ab. Zwar verhängten die USA und die EU-Sanktionen wegen der Unterdrückung der Uiguren, von deren Zwangsarbeit westliche (Mode-)Marken und Unternehmen profitier(t)en (zum Beispiel Nike und H&M), und wegen des harten Vorgehens Chinas gegen Hongkongs Demokratiebewegung. Doch ist das genug? Nach dem chinesischen Boykott internationaler Marken haben z.B. VW und H&M bereits wieder ihr Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit China signalisiert. Glauben Sie, dass auch diesmal wieder die Wirtschaft siegen wird? Was sollten wir tun? Die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter für die Fast-Fashion-Industrie ist Kolonialismus in neuem Gewand. Welche soziale, welche persönliche Verantwortung haben wir?
Ich habe das Gefühl, dass Sie meinen Roman besser verstehen als ich. Nein, im Ernst: Sie haben Recht. Meine Antwort ist Ja. Ich mache mir um all das Sorgen, was Sie ansprechen. Diese Fragen sind alle im Roman. Die Antworten leider nicht. Wenn ich die Antworten wüsste, wäre ich wahrscheinlich ein renommierter Ökonom und würde nächsten Monat nicht an der Sommerschule unterrichten.
Aber ich versuche zu antworten. Nein, ich glaube nicht, dass die sogenannte westliche Welt genug tut, um die Situation zu verbessern oder Konzerne zu zwingen, sich zu ändern. Wo ist der Anreiz zur Veränderung? Trump, die Uiguren in Xinjiang, das harte Vorgehen gegen Hongkongs Regenschirmbewegung – die Dinge scheinen schlimmer als je zuvor. Als Trump einen Handelskrieg gegen China begann, verließen viele große Hersteller China präventiv und zogen ihre Fabriken nach Vietnam, Indien und Bangladesch ab. Fedor sagt so etwas im Roman – das Problem wird niemals gelöst, sondern nur verschoben. Billige Produkte folgen billiger menschlicher Arbeit. Kapitalismus als Neo-Kolonialismus. Diese Konzerne kommen in diese Länder und schreien: „Wir bringen Jobs und Geld und Waren, die euer Leben verbessern werden.“ Aber Veränderungen müssen auch bei den Konsumenten und Konsumentinnen stattfinden. Man sieht, dass der Druck der sozialen Medien auf die großen Konzerne positive Effekte hat. Aber solange wir wollen, dass Amazon-Päckchen aus den Wolken herabschweben und sanft auf unseren Türschwellen landen, müssen wir weiterhin wegschauen.
Alex hat die Vision einer friedlichen und gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen ihm und den chinesischen Arbeiterinnen und Arbeitern, zwischen Amerika und China.
Ja, ich glaube, dass es einen Anflug von Hoffnung am Schluss des Romans gibt. Einige Leserinnen und Leser sagten mir, dass dieses Ende idealistisch oder naiv klingt. Und ihnen sage ich: „Ja!“ Können wir bitte idealistisch und naiv bleiben? Vielleicht werden sich die Dinge tatsächlich verbessern und vielleicht können Menschen wirklich eine angemessene Gesundheitsversorgung erwarten, reines Wasser, gute öffentliche Schulen und eine nicht-rassistische Polizei. Ich glaube nicht, dass das idealistisch ist – das ist das Basisniveau, das wir von unserer Gesellschaft erwarten sollten. Wie auch immer: Es sind immer die Menschen in Machtpositionen, die den Idealismus ablehnen, weil sie nicht wollen, dass die Dinge sich ändern. Sie haben zu Recht Angst vor dem Idealismus.
Die Pandemie hat viele Fragen aufgeworfen, die mit Lieferketten, mit gerechter Impfstoffverteilung usw. zu tun haben. Haben Sie Hoffnung, dass wir uns dessen bewusster werden, dass wir voneinander abhängig sind, dass es uns nur dann gut geht, wenn jeder seinen Teil des Kuchens abbekommt?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen nun sehen, wie sehr wir miteinander verbunden und aufeinander angewiesen sind. Die Pandemie hätte uns das unmissverständlich klarmachen müssen. Aber in Amerika wurde die Pandemie zu einem so starken Politikum und das auf die tragischen Kosten so vieler Menschenleben, dass ich nicht sicher bin, was die Menschen daraus gelernt haben – falls sie überhaupt etwas gelernt haben. Was sehr beängstigend ist.
Als Jude versteht Alex ursächlich, was Leiden bedeutet, und er zeigt große Empathie für die Chinesen und Chinesinnen. Darf ich Sie fragen: Haben Sie, hat Ihre Familie Verwandte in der Shoah verloren?
Nein, meine Familie floh vor den Pogromen und der Armut in Osteuropa (Polen, Litauen), und kam Anfang des 20. Jahrhunderts nach Amerika. Aber wenn man jüdisch aufwächst, wird einem die Erfahrung der Shoah so stark und so tief eingeprägt, dass es sich anfühlt, als hätte man damals selbst Familie verloren. Das sind wirklich traumatische Bilder und Geschichten, die man schon sehr früh sieht und hört, die immer wieder wiederholt werden mit dem Mantra: Niemals vergessen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, nur, dass es eine große Wirkung hat. Meine Großeltern waren verständlicherweise zutiefst erschüttert, daher war es immer im Bewusstsein meiner Familie und in meinem verankert. Das zeigt sich deutlich im Buch und wird dann in Verbindung gebracht mit einigen signifikanten traumatischen Ereignissen in der Geschichte des modernen China – dem Tian`anmen-Massaker und der Kulturrevolution. Als ich in China lebte, war ich erschüttert darüber, wie viel die chinesische und die jüdische Kultur gemein haben: den Sinn für Humor, die neurotischen Familien, die Werte. Ich liebte es, das zu entdecken, als ich in China Freunde fand. Das hat zur Form und Gestaltung des Buchs beigetragen, besonders, was die tiefe Verbindung betrifft, die sich zwischen Alex und Ivy entwickelt.
Ihr Roman behandelt ernste Themen und ist doch immer voller Humor und Witz. Ist das essentiell für Sie?
Inzwischen ist es fast schon ein Klischee, wenn man sagt, dass der Humor ein großer Teil der jüdischen Kultur ist. Es ist ja nicht so, als würden Ecuadorianer/innen oder Österreicher/innen den ganzen Tag stirnrunzelnd herumsitzen und sich keine guten Witze ausdenken können. Das andere Klischee ist, dass Humor den Menschen (Juden) bei der Bewältigung ihrer Traumata hilft. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, Humor erfordert ein gewisses Maß an Komfort und Privilegien, um zum Ausdruck kommen zu können. Ich bezweifle, dass die Schoah für die Opfer so lustig war. Als ich heranwuchs, war meine Familie nicht sehr komisch – und wie hätte sie das sein können, wenn man die ganze Zeit über Krebs spricht? Ich weiß nicht, woher ich meinen Humor oder trockenen Witz habe. Ich nehme an, es ist eine Weltanschauung. Ich kann Humor nicht besser erklären als ein gutes Musikstück. Ich weiß, dass er essentiell ist für meine Art zu schreiben und für meine Art, die Welt zu sehen. Und eine humorlose Welt ist ein beängstigender Ort. Aber man kann es leicht zu weit treiben, und dann ist alles höhnisch, sarkastisch oder unwichtig. Viele Dinge sind überhaupt nicht lustig. Es gibt Zeiten, da müssen Menschen im wirklichen Leben oder in der Fiktion wenigstens versuchen, ehrlich und aufrichtig miteinander und mit sich zu sein. Weil Dinge zählen, wichtig sind. Nicht alles ist ein Witz. Daher versuche ich, im Buch und in meinem Schreiben die richtige Balance zu finden zwischen Humor und Ernsthaftigkeit.
—
Spencer Wise, 1970 in Boston geboren, ist Dozent für Kreatives Schreiben an der Universität Augusta. Neben Veröffentlichungen in Zeitschriften wie dem „Narrative Magazine“ oder „The Florida Review“, hat er beruflich ebenso im Ausweiden von Hühnern, dem Verkauf von Ginsu-Messern oder in einer Schuhfabrik in Südchina Erfahrungen gesammelt. „Im Reich der Schuhe“ ist sein Debütroman, 2018 erschienen.
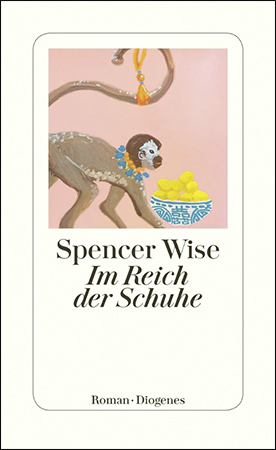
Spencer Wise
Im Reich der Schuhe (Diogenes)
Ü: Sophie Zeitz, 400 S.













