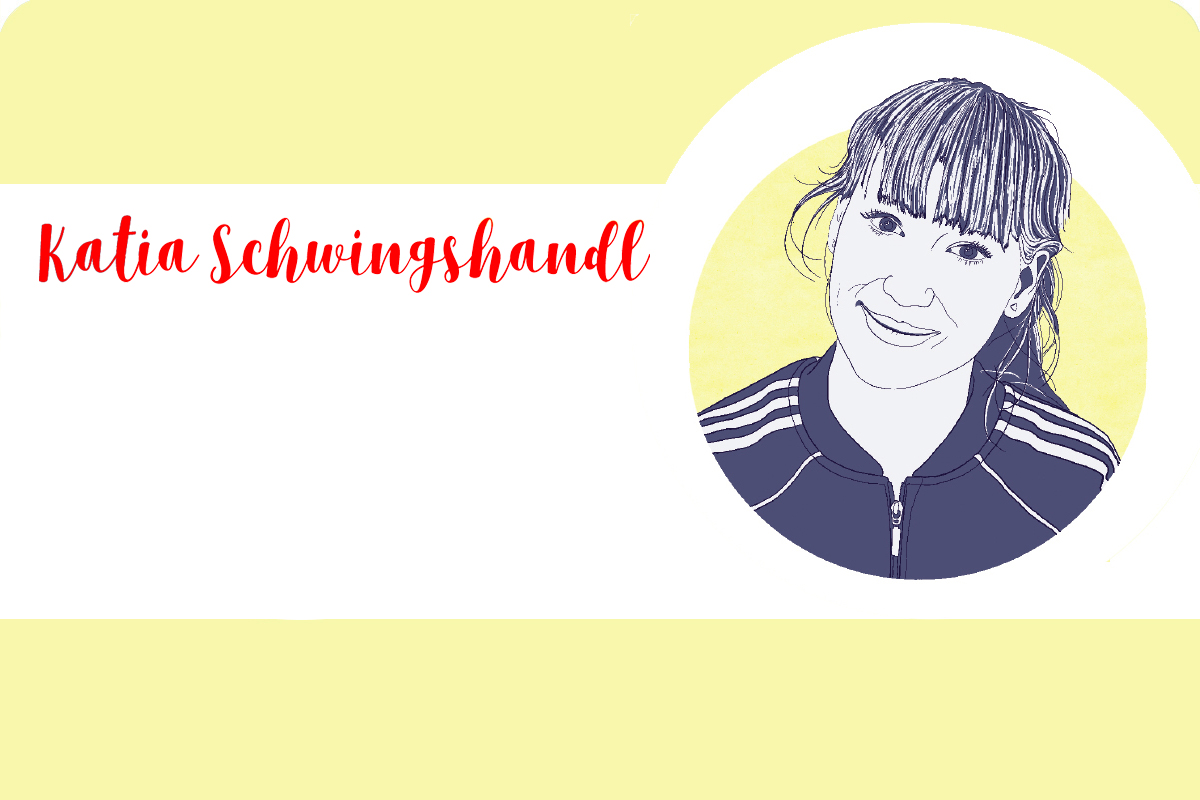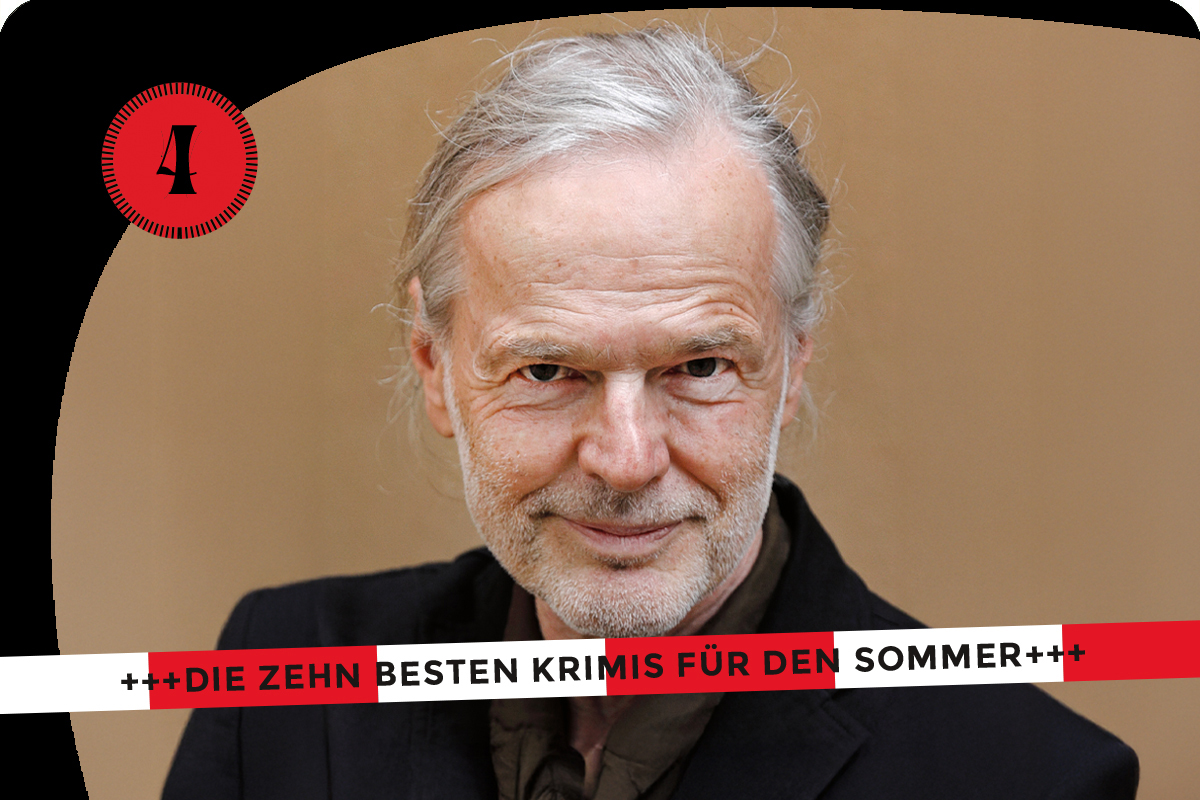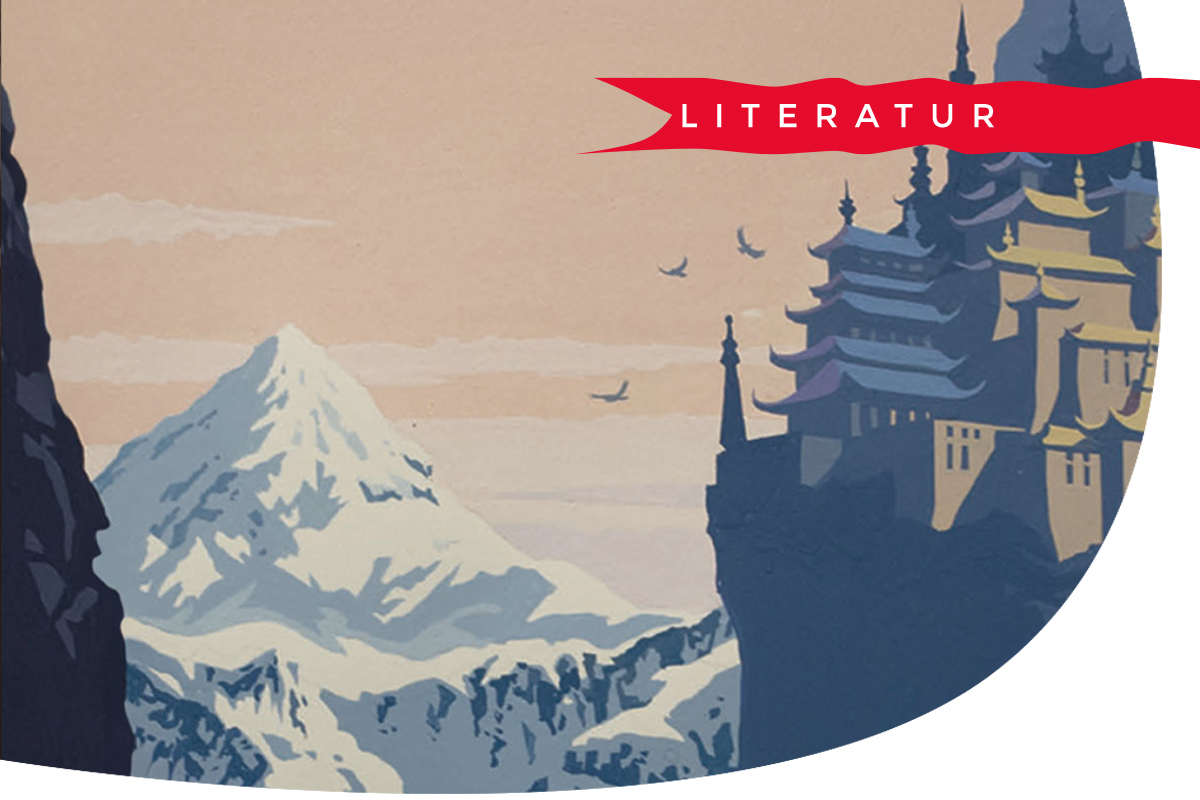Immer wieder und immer wieder neu – besonders aber jetzt, wo es um die Planung dieses ersten von mir betreuten Heftes ging – stellte und stellt sich mir die Frage: Wie will Literatur in Szene gesetzt werden? Wie soll Literatur, die zu einem vertiefenden Diskurs anregen soll, für unser Publikum passgerecht aufbereitet werden? Nun, Buchkultur als solches, als Magazin, hat sich da ja praktischerweise schon festgelegt und beantwortet diese Frage simpel: Als Printmedium zelebriert es das Lesen der darin präsentierten Bücher mittels Lesen selbst. Texte über Texte.
Andere Medien stehen da oft vor größeren Herausforderungen: Literatur in Ton? Literatur im Bild? So zum Beispiel das Fernsehen, dem in dieser Hinsicht wirklich alle Möglichkeiten offenstehen. Das bedeutet aber auch: Mehr Platz, um sich zu verrennen.
Es ist ein wenig schade, dass der Bachmannwettbewerb zum Erscheinungszeitpunkt dieses Heftes bereits zwei Monate her ist, denn er eignet sich immer hervorragend dazu, das mediale Literaturgeschehen des Landes zu veranschaulichen. So etwas Ähnliches dürfte sich auch Sophie Passmann gedacht haben. Die »Tage der Deutschsprachigen Literatur«, wie sie seit Jörg Haider heißen, waren auch für sie die ideale Steilvorlage, um gegen das verstaubte österreichische »superlangweilige« Literaturfernsehen zu sticheln, wie eben nur Sophie Passmann sticheln kann. Klagenfurt eignete sich hervorragend, um in einem Artikel der ZEIT (noch bevor sie feministischen Unmut auf sich zog) die »verklemmte Lässigkeitspose« der Moderator/innen zu bekritteln, das »loungende« Publikum in seinen lahmen Strandstühlen durch den Kakao zu ziehen, die Autor/innen, zu bemitleiden, »die noch mit 40 als Nachwuchs gehandelt werden«.
Klar: Sophie Passmann macht es sich ziemlich einfach, das durchschauten auch die Kommentare darunter problemlos. Statt der qualitativen Fülle, aus der diese Literaturveranstaltung (auch) besteht – die Jury(dis)positionen, Literatur(aus)richtungen, Geschmackfragen und Performances –, kritisiert sie die reine Hülle. Nicht nur ist die Annahme, dass eine Literatursendung wie diese mehr Zuseher/innen generierte, wenn daraus »besseres Fernsehen« würde (was auch immer das sein soll), herzig und naiv, nein, ihr Artikel schlägt zudem genau in die Kerbe, für die sie bekannt ist: Sophie Passmann verschafft sich Aufmerksamkeit, indem sie laut, provokant und ironisch ist. Aber: Muss auch eine Literatursendung laut, provokant und ironisch sein?
Mit dem anstehenden Fernsehformat in den USA, für das zurzeit fleißig gecastet wird, hätte Passmann wohl ihre größte Freude. Es liest sich quasi als Alternativveranstaltung zum Bachmannpreis und heißt: America’s Next Great Author. Und nein, das ist kein Witz. Präsentiert vom Bestsellerautor Kwame Alexander, haben angehende Autor/innen live auf Sendung eine Minute lang Zeit, um die perfekte Romanidee zu pitchen. Sechs Finalist/innen werden anschließend auf »Schreibretreat« geschickt und werden dazu gezwungen, ihre Romane in nur dreißig Tagen von Seite eins an fertigzuschreiben. Zugegeben: Vermutlich würde ich mir die Show sogar anschauen. Doch wie viel Inszenierung, wie viel Populismus verträgt Literatur?
Die Frage sprengt den Rahmen dieser Kolumne und muss von jeder/m für sich selbst beantwortet werden. Gerade aber beim diesjährigen Bachmannwettbewerb hat sich für mich etwas gezeigt, was Sophie Passmann sehr wahrscheinlich übersehen hat. (Ein Schelm, der ihr unterstellte, sich gar nicht die jeweils einstündigen Lesungen inklusive Jurydiskussion angesehen zu haben und sich gar nicht näher mit den Texten selbst aufgehalten zu haben.) Klagenfurt hat mir, mit seinen vier außerordentlich starken weiblichen Gewinnerinnen der letzten Jahre, mehr noch mit der Gewinnerin des diesjährigen Bewerbs gezeigt, wie erfrischend es ist, dass eine Autorin, die keiner so richtig am Schirm hatte, sich so deutlich durchsetzen konnte und wie befriedigend, dass ihr Roman, der zwei Jahre lang vor uns gelegen ist, nun Beachtung findet. Oder wie Jan Wiele von der FAZ schreibt: »Der Wettbewerb […] in Klagenfurt ist das Gegenkonzept zur […] Verstümmelung von Literaturkritik – eine fast schon letzte Bastion der intensiven bis manischen Beschäftigung mit literarischen Texten über mehrere Tage am Stück, mit einer nach Gesetzen heutiger Aufmerksamkeitsökonomie fast schon verrückt langen Verweildauer bei einem Text.« Ein Hoch auf die 40-jährigen Nachwuchsautorinnen!