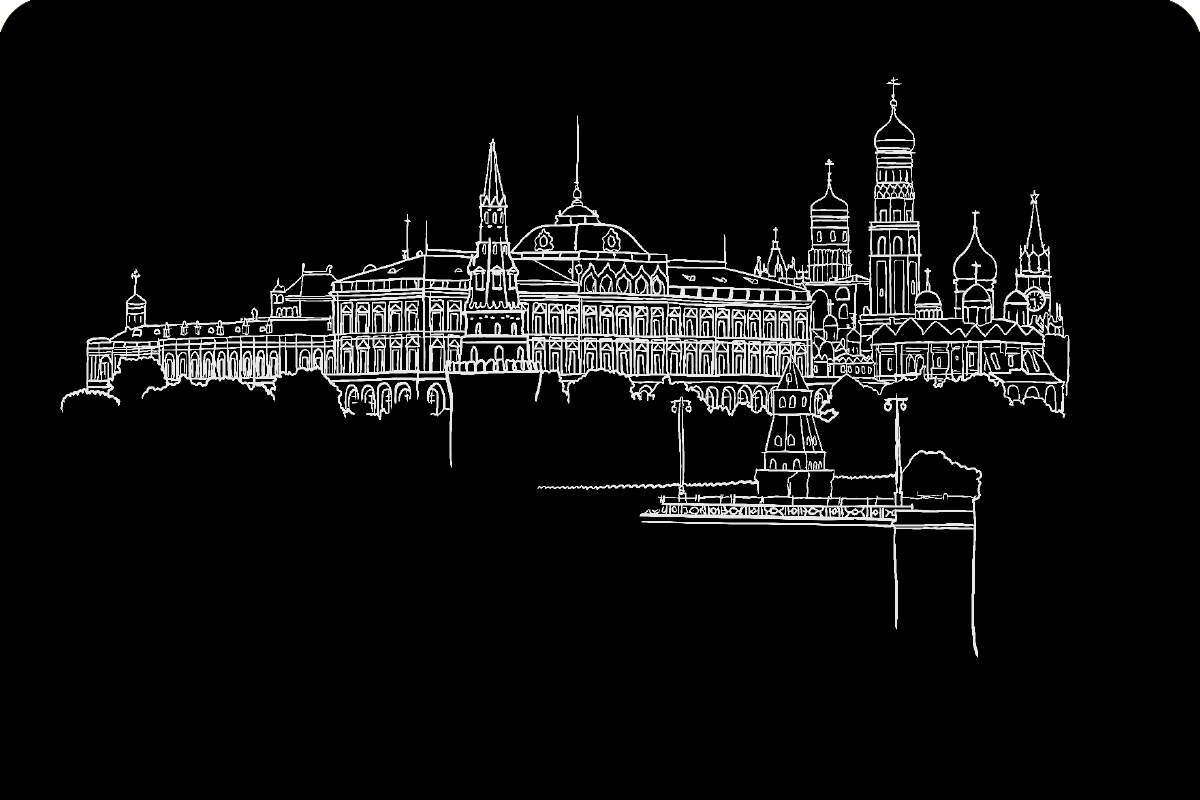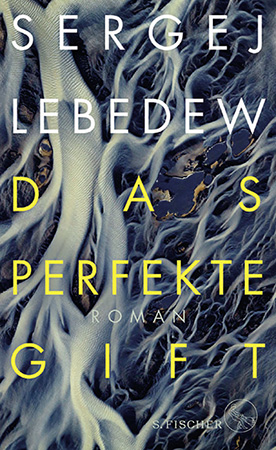In den letzten Jahren schafften es bemerkenswert wenig russische Krimis auf den deutschsprachigen Markt. Warum eigentlich? Wir haben Wiederentdeckungen und Neuerscheinungen gelesen. Illustration: Jorghi Poll.
In den 1990er- und 2000er-Jahren gab es eine kleine Welle russischer respektive postsowjetischer Kriminalliteratur auf dem deutschsprachigen Markt, wohlgemerkt autochthoner russischer Autor/innen. Die üblichen einschlägigen Narrative von außen über die Sowjetunion, Russland und andere Republiken, also alles seit John Le Carré oder Martin Cruz-Smith, lassen wir hier mal beiseite.
Boris Akunin, Polina Daschkowa, Alexandra Marinina, Darja Donzowa oder Anna Malyschewa, um nur ein paar Namen zu nennen, waren hier zwar nie wirklich fette Bestseller, aber sie wurden doch regelmäßig wahrgenommen. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben in unserem Fokus, zumindest nicht, wenn es um »reines« Genre geht. Hybrid-Autoren wie Dmitry Glukhovsky operieren eher in Richtung Science-Fiction, die, siehe Sergej Lukianenko, auch bei uns wahrgenommen werden – allerdings vermutlich von einer anderen Zielgruppe.
Stellt sich also die Frage, woran das liegt. Ist das Interesse des Lesepublikums so gering geworden, dass sich teure Übersetzungen nicht mehr lohnen? Sind die üblichen literaturbetrieblichen Pipelines, über die Bücher gehandelt werden, ausgetrocknet? Werden in Russland einfach keine sortenreinen Kriminalromane mehr geschrieben? (In der Tat: sehr wenige gute, sagten mir ein paar Verleger/innen in Moskau schon vor zwei Jahren.) Oder hat sich das, was man Kriminalroman oder Politthriller nennen könnte, so verändert, dass die alten Etikette unbrauchbar geworden sind?
Zwei Neuauflagen, übersetzt von Beate Rausch bei Matthes & Seitz, zeigen die Gemengelage sehr schön: »Der gute Stalin« (2002), und die »Enzyklopädie der russischen Seele« (2002) von Viktor Jerofejew. Die Räson einer Wiederveröffentlichung liegt auf der Hand – beides sind Bücher, die sich mit Autokratie und Autokraten beschäftigen, mit Weltmachtfantasien und banalster Lebenswelt unter solchen Umständen. »Der gute Stalin« ist ein autobiografisch grundierter Roman von Jerofejew, über sich und seinen Vater, der ein hoher Diplomat unter Stalin und noch unter Chruschtschow war, und wegen der dissidenten Umtriebe seines Sohnes schließlich politisch kaltgestellt wurde. Jerofejew junior war eine Art »enfant terrible« der sowjetischen Literaturszene in den 1970er-Jahren, seinen Vater beschreibt er als »den guten Stalin«. Und zeichnet ein eindrückliches Gesellschafts- und Sittenporträt der stalinistischen und poststalinistischen Nomenklatura: den Luxus der Führungsschicht, die kargen Lebensumstände der »einfachen Leute«, die permanente Angst und den Terror des Systems, den Opportunismus der Günstlinge, und die Überzeugung vieler Beteiligter, dass der Kommunismus all die Grausamkeiten dennoch wert sei. Viktor Jerofejew schreibt natürlich keine Apologie des Stalinismus, sondern versucht, dessen politische und psychologische Feinmechanik auf narrativem Weg zu verstehen, die Geschichten hinter der Geschichte sichtbar zu machen. Im Grunde das Kerngeschäft eines Politthrillers, auch wenn er hier als autobiografischer Roman auftritt.
Die »Enzyklopädie der russischen Seele« hingegen hat paradoxerweise mehr Plot-Anteile, obwohl die narrativen Passagen wesentlich karger ausfallen. Das geht so: Ein Intellektueller und ein Agent werden von einem hohen Geheimdienstgeneral losgeschickt, um die Chancen für ein neues russisches Großreich weltweit zu sondieren – wir sind am Anfang der Putin-Ära – und »den Grauen« zu finden, eine menschgewordene Metapher für eine Art »russischen Nationalcharakter«. Aber diese Queste muss man sich bei der Lektüre aus Andeutungen und kleinen Handlungspartikeln zusammenbauen, denn Jerofejews Text besteht aus Reflexionen, Pamphleten, Fragmenten, Nonsens, Exkursionen und anderen »kleinen Formen« mehr zu stichwortartig angeordneten Aspekten der »russischen Seele«, mit Spott, Hohn, Verzweiflung und tiefem Ernst gespickt – irgendwo zwischen Daniil Charms, Bulgakov, Majakowski, Achmatova (bei allen Büchern Jerofejews ist jeder dritte Satz literarisch doppelt codiert, naja, das ist leicht übertrieben …) und einer Menge Roland Barthes’ »Mythen des Alltags«. Bachtin pur: das Profane und das Heilige. Faszinierend.
Auch Sergej Lebedews Politthriller »Das perfekte Gift« (bei S.Fischer, dt. von Franziska Zwerg) oszilliert zwischen Diskurs und Plot. Ein russischer Geheimdienstoffizier wird ausgeschickt, um einen einst in sowjetischem Dienst gestandenen Biochemiker zu liquidieren, der den supertödlichen Stoff, genannt »Der Debütant« identifizieren könnte, mit dem der russische Auslandsgeheimdienst gerade einen Dissidenten in Tschechien ermordet hat. Kalitin, der Wissenschaftler, hat diesen Stoff schließlich selbst in einer hochgeheimen Wissenschaftsstadt irgendwo in der Sowjetunion entwickelt, mit Hilfe grausamster, zynischer Menschenversuche (man nannte die Opfer »Gliederpuppen«). Während der Killer näher kommt, reflektiert und rekapituliert Kalitin, dies wissend, sein Leben und Wirken, und der Killer denkt über das schmutzige Spiel der Geheimdienste nach, während er natürlich gehorsam mitspielt. Klar, das Buch spielt auf die diversen Nowitschok-Affären an (Nawalny kann noch nicht gemeint sein, das Buch ist 2020 schon erschienen), auf die Tradition der biochemischen Waffenentwicklungen, auf die heuchlerische Diskussion um Saddam Husseins »Weapons of Mass Destruction«. Lebedew sagt zwar andauernd Sowjetunion und Russland, meint aber durchaus »den Westen« mit, der im Kalten Krieg die entsprechenden Forschungen genauso betrieben hatte. Die Pointe des Romans ist fürchterlich ironisch – die jeweiligen Subtexte, die Einblicke in das Denken der Wissenschaftler und ihrer politischen Herren sind nicht unbedingt verblüffend, aber sehr instruktiv.
Genre pur hingegen ist »Tod in weißen Nächten« von G. D. Abson bei Rowohlt (dt. von Kristof Kurz, die Bio hat was von Pseudonym). Eine schon fast klassischen Cop Novel aus St. Peterburg, im Buch gerne »Piter« genannt. Die toughe Kriminalpolizistin Natalja Iwanowa muss eine vermisste schwedische Studentin finden, während sich um sie herum die Leichen türmen. Und natürlich geht es nicht nur um die verschwundene junge Frau, sondern um Geld, viel Geld, um dubiose Geschäfte, um das Organisierte Verbrechen, um Oligarchen (in diesem Fall ein Schwede) und vor allem um die Rolle einer zutiefst korrupten und autokratischen Regierung, deren Inlandsgeheimdienst FSB die größte verbrecherische Organisation von allen ist. Als Beifang bietet der Roman viel Kontext über das Leben in Russland, speziell in St. Petersburg heute, über die Geschlechterverhältnisse, über die psychosoziale Verfasstheit der Menschen. Iwanowa ist stur, notfalls gewaltaffin, nicht beeindruckbar, nicht bestechlich. Sie ist als Figur heutzutage internationaler Standard, so wie der ganze Roman internationaler Standard ist. Kein Grund, Klischee zu schreien oder Klon, denn um zu funktionieren – das tut er nämlich –, muss er eine gewisse innere Plausibilität haben. Oder um Johnny Cash zu zitieren: »I don’t like it, but I guess, things happen this way.«
—
Viktor Jerofejew, „Der gute Stalin“ (Matthes & Seitz)
Ü: Beate Rausch, 409 S.
Viktor Jerofejew, „Enzyklopädie der russischen Seele“ (Matthes & Seitz)
Ü: Beate Rausch, 420 S.
Sergej Lebedew, „Das perfekte Gift“ (S. Fischer)
Ü: Franziska Zwerg, 256 S.
G. D. Abson, „Tod in weißen Nächten“ (Rowohlt)
Ü: Kristof Kurz, 448 S.