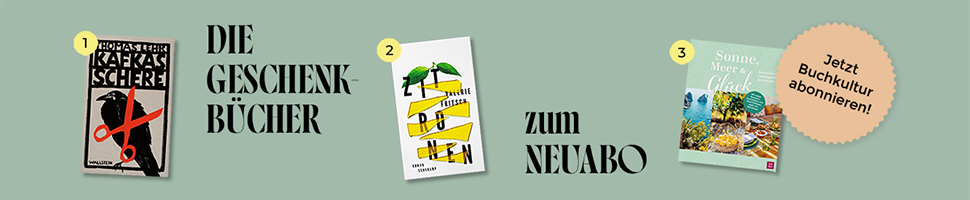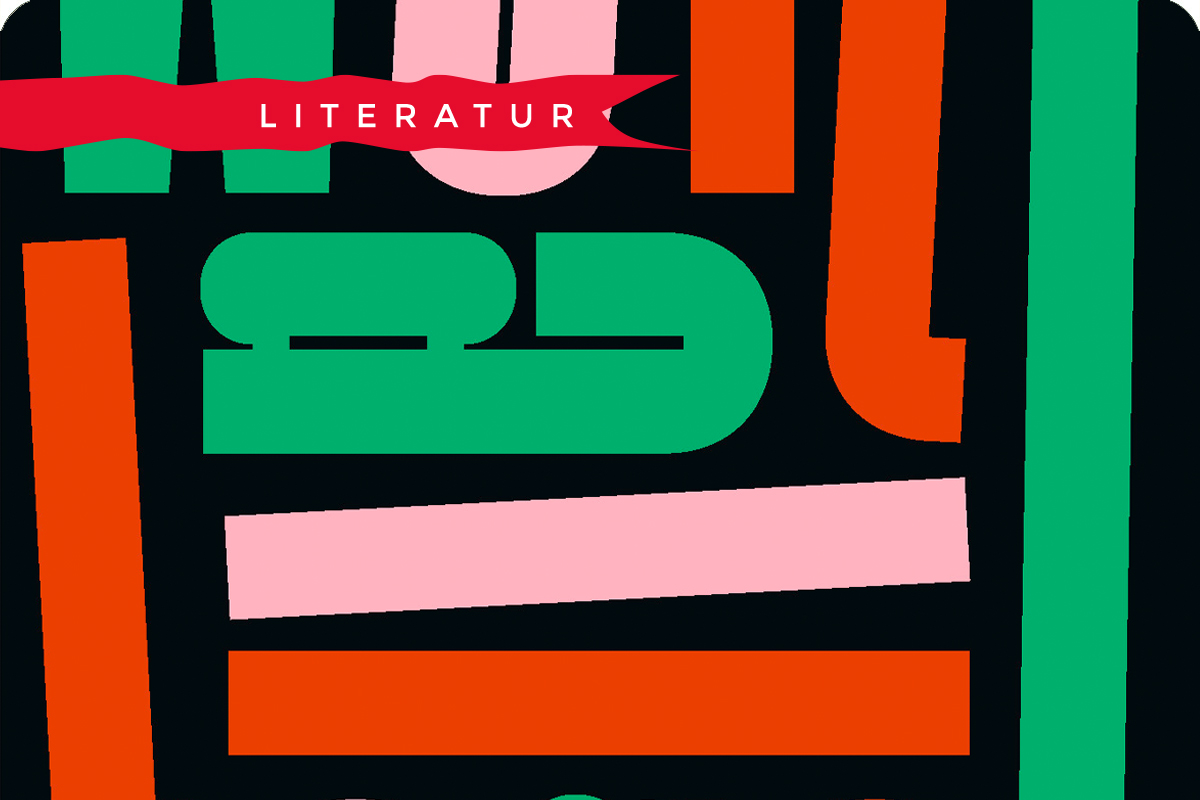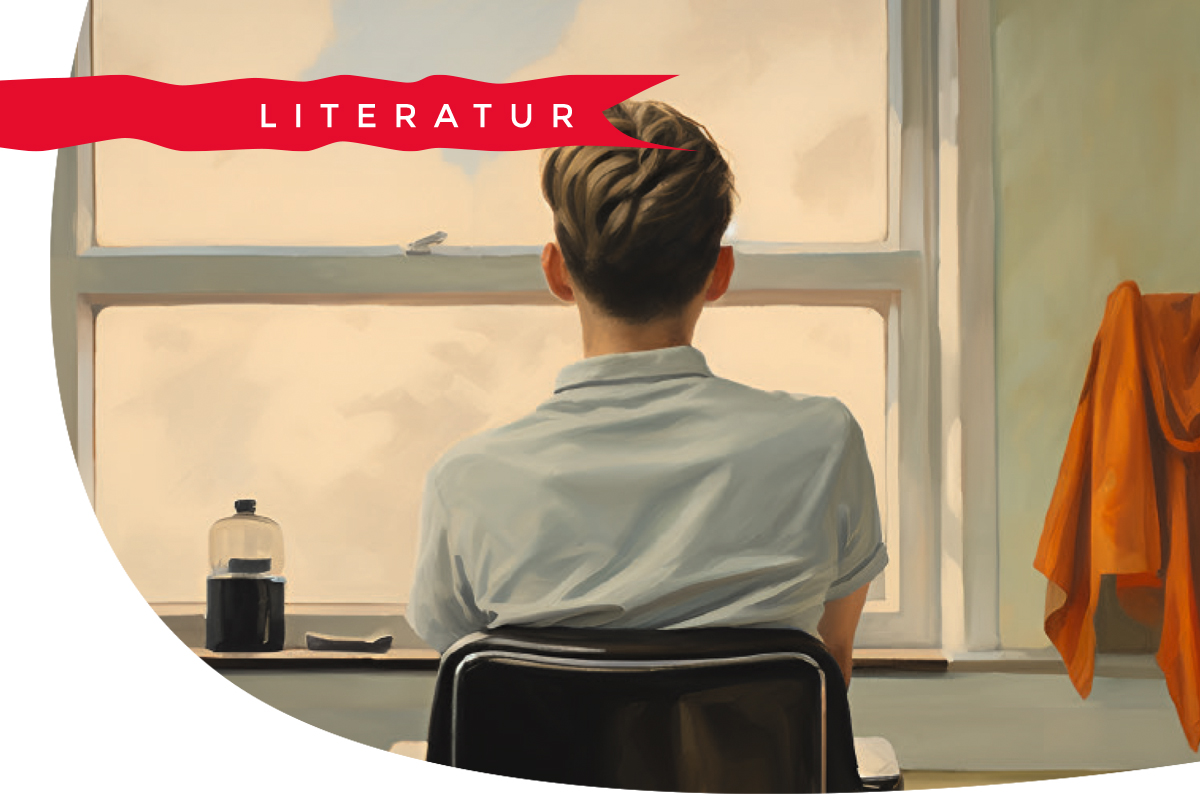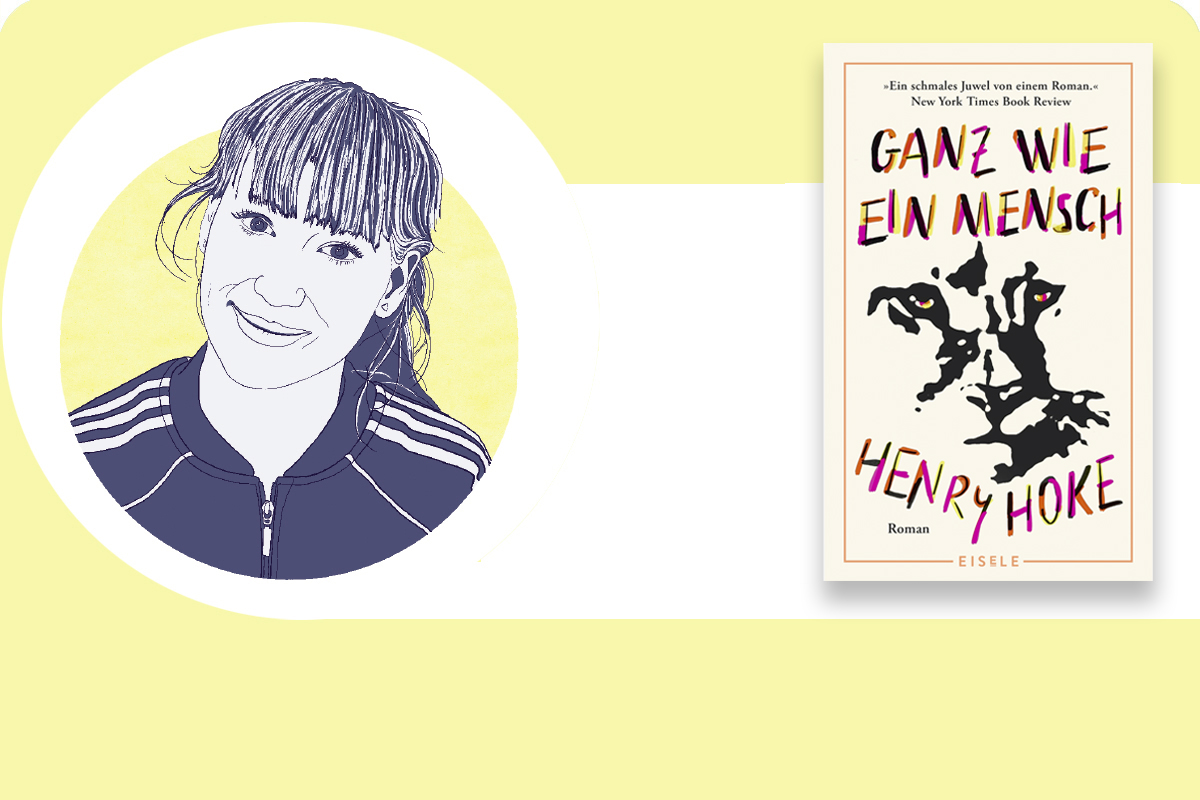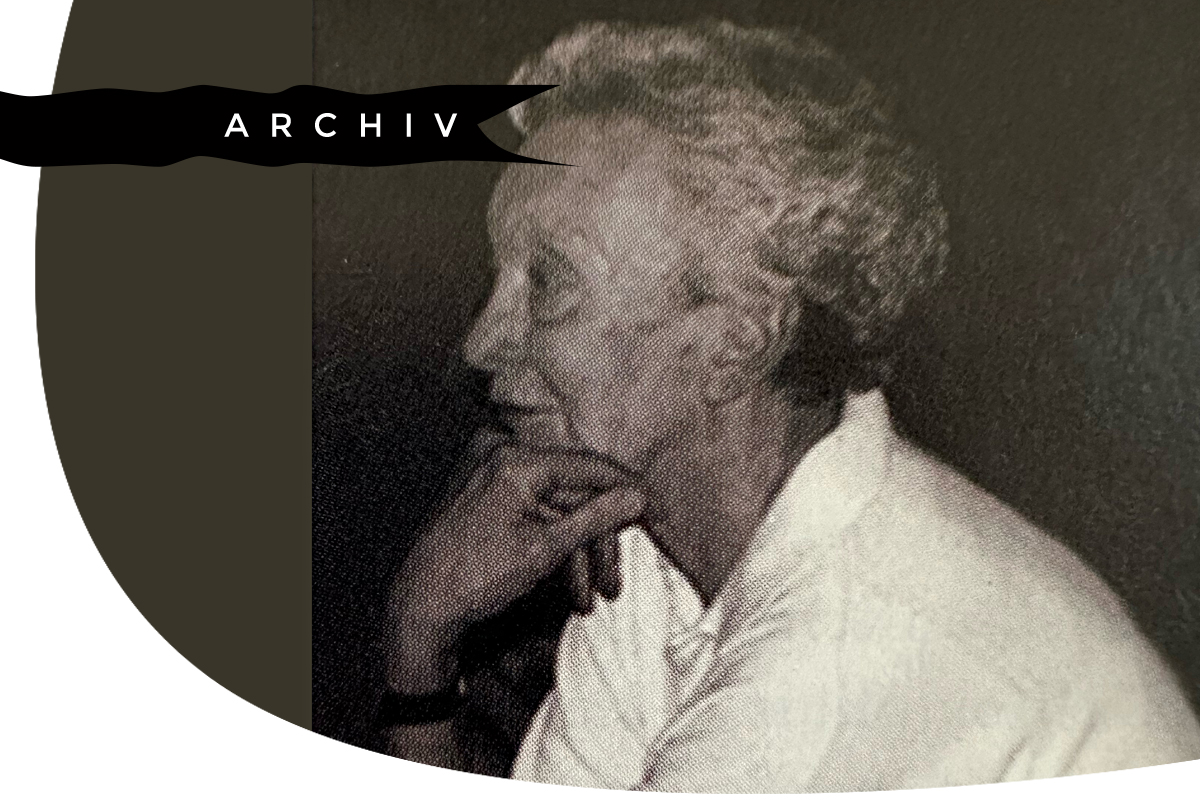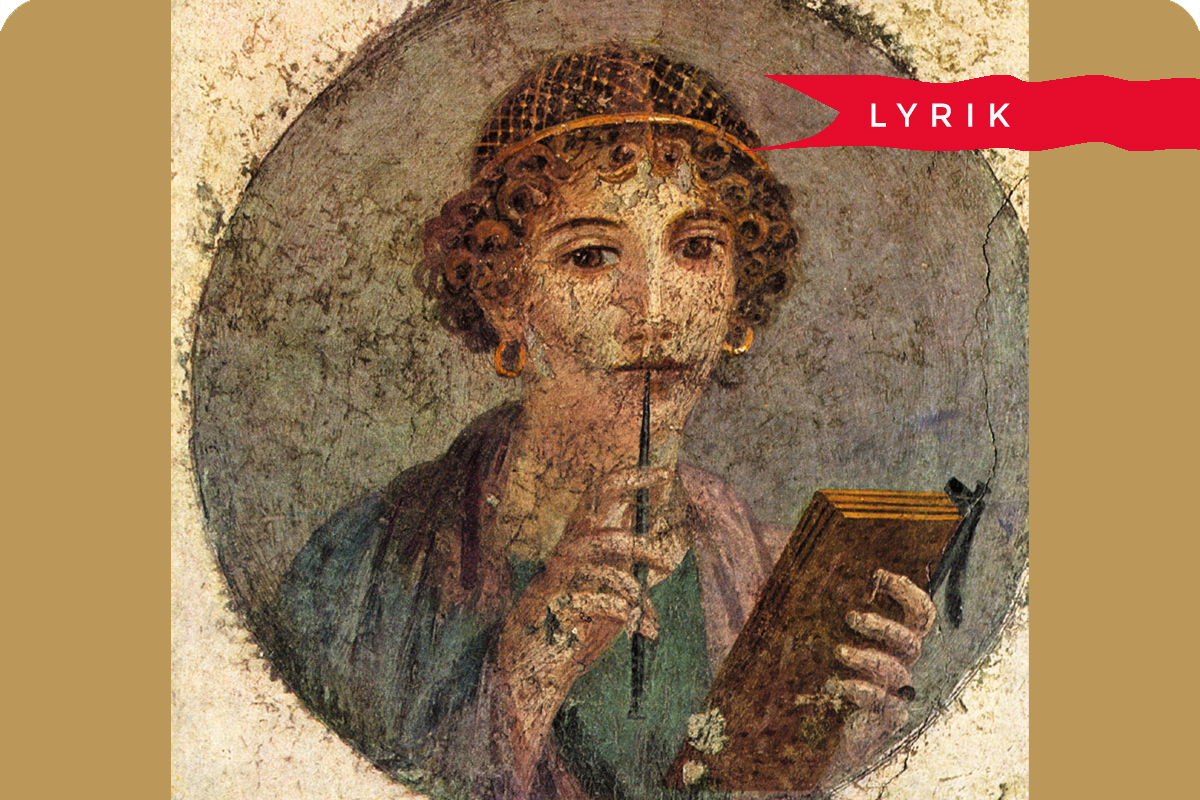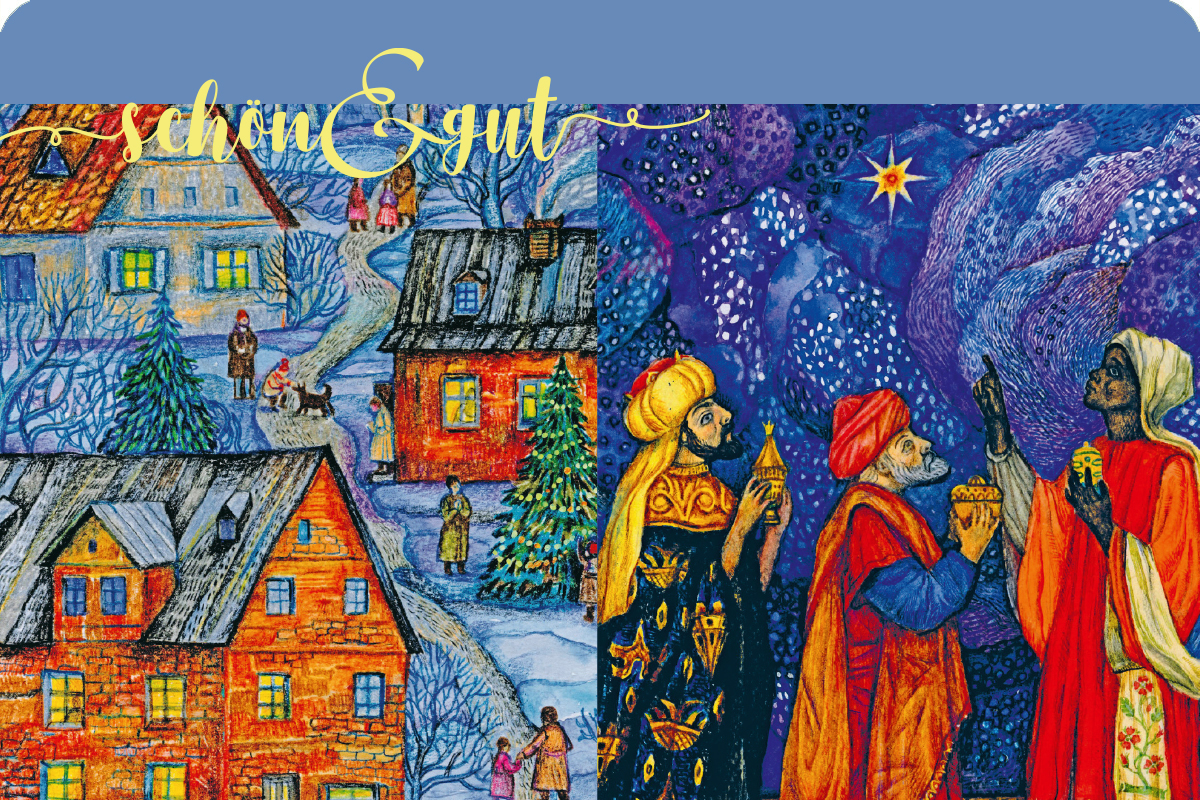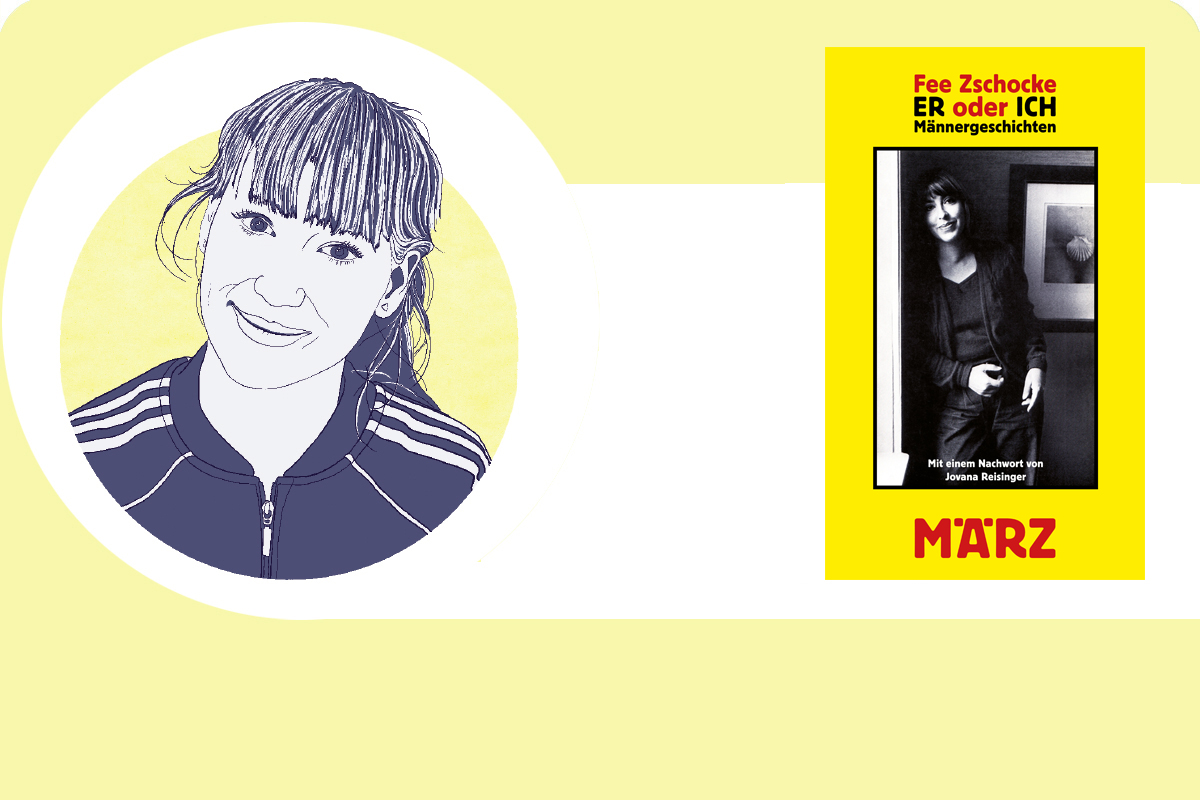Kirsten Fuchs und ihre „Mädchenmeute“ sind wieder unterwegs. In „Mädchenmeuterei“, der Fortsetzung, gehen Charlotte, Yvette, Freigunda und Antonia an Bord eines Containerschiffs mit Kurs nach Marokko, um ihrer Freundin Bea zu helfen. Die steckt dort mit ihrem Vater, einem Fernfahrer, in Schwierigkeiten. Doch auch an Bord der „Lexy Barker“ geht einiges mit unrechten Dingen zu. Den Preis für unsere Freiheit zahlen oft andere. Die Mädchen wachsen weit über sich hinaus – in ihrem Verständnis füreinander und für die komplexen Zusammenhänge der Welt. Ein großes, berührendes und ungeheuer authentisches Buch übers Erwachsenwerden, über Freundschaft, Freiheit und Verantwortung. Die vielfach ausgezeichnete Lesebühnen-Autorin im Interview. Foto: Paul Bokowski.
Buchkultur: Welches der Mädchen ist Ihnen am nächsten?
Kirsten Fuchs: Ich sage normalerweise, dass ich der Charlotte am nächsten bin. Sie ist ja auch die Erzählerin. Das kommt auch aus diesem Nicht-Sprechen-Können, wenn man schüchtern ist. Das Schreiben ist dann ein gutes Vehikel, mit Menschen zu kommunizieren. Oder länger über etwas nachdenken zu können. Das war bei mir auf jeden Fall auch ein Grund, zu schreiben. Und dass man alle möglichen Abenteuer erleben kann, ohne dass man sie erleben muss.
Sie waren auch sehr schüchtern?
Ja. Ich war als Kind ziemlich schüchtern, auch in der Pubertät noch. Aber wenn ich das Leuten erzähle, sehen die das oft nicht. Wenn ich vorlese, ist es etwas völlig anderes, weil ich mich hinter dem Text verstecken kann. Vor den ersten Schullesungen hatte ich tierische Angst. Und vor den Kindergartenlesungen ging es mir auch wieder so. Ich habe mir dann zugelegt, das alles interessant und lustig zu finden, und das ist es auch. Das klappt ganz gut, aber es ist immer mit einem Widerstand verbunden. Ich würde mich lieber verstecken.
Um auf Ihre erste Frage zurückzukommen: Ich fühle mich aber auch wie Freigunda. Nicht von diesem Knappen und Strengen her, sondern von dem, was sie alles kann, diesem Indianermäßigen. Etwas machen. Das ist auch ein großer Teil von mir. Ich bin ja im Garten sehr glücklich. Ich finde auch Yvette toll. Die wird von vielen Testlesern als unsympathisch abgelehnt und so wird sie auch geschildert. Aber ich finde vieles an ihr toll. Dass sie auf ihre Bedürfnisse so stark achtet. Ich finde auch, dass man sagen sollte, das ist mir zu viel, das mag ich nicht. Und sie kämpft ja nicht nur für sich. Sie ist gar nicht so egoistisch.
Man erfährt ja auch, dass sie gemobbt wurde und sie sich diese Schlagfertigkeit wie eine Art Schutzwall aufgebaut hat.
Nee, so einfach hat sie es wirklich nicht. So liebevoll ist ihre Familie ja auch nicht. Das Geld ist da, aber keine so große Nähe. Deshalb hat sie wahrscheinlich diesen harten Humor. Das ist ja ihre Stärke. Die Mädchen haben alle ihre unterschiedlichen Kräfte. Es ist ja auch in Ordnung, wenn Menschen unterschiedlich sind und dann gut zusammenarbeiten. Am Anfang sind sie ja keine richtige Gruppe, sondern zufällig zusammen. Aber im zweiten Teil funktioniert das sehr gut: Dass die eine an der richtigen Stelle ihre Schwäche überwindet. Oder bei der anderen das, was immer als Schwäche empfunden wurde, auf einmal eine Stärke ist. Das klappt immer so hin und her.
Auch das Verständnis der Mädchen füreinander wächst. Ist „Mädchenmeuterei“ so ein bisschen die Bewährungsprobe für ihre Freundschaft?
Sie haben im zweiten Teil immerhin eine Vision und eine Mission. Das haben sie im ersten Teil nicht. Da geraten sie so hinein und sind unbesorgt. Weglaufen und so vor sich hin den Sommer zu verbringen, ist ja erstmal kein Ziel. Aber im zweiten Teil gibt es das. Und sie haben ein gutes Ziel. Sie wollen ja keine Bank ausrauben, sondern jemandem helfen – das steht gleich unter einem anderen Stern.
Die Mädchen haben alle ihr Päckchen zu tragen. In Freigundas Familie, das deuten Sie nur an, gibt es offenbar Gewalt?
Ja. Das ist schon eine recht radikale Szene, aus der Freigunda kommt. Ich hatte aber keine Lust, das hinzuschreiben. Man riecht das so genug.
In „Mädchenmeuterei“ erfahren wir viel über das (Innen-)Leben der Mädchen, ihre Familien, ihre Probleme, und sie müssen sich auch wieder mit ernsten Themen, mit Tod und Sterben auseinandersetzen. Charlotte wiederum lernt schätzen, was sie zuhause an ihren Eltern hat.
Das ist im ersten Teil viel flapsiger, das so abzubürsten, wie uncool die Erwachsenen sind. Was den Mädchen in dem Alter ja auch zusteht. Aber Charlotte erkennt, dass sie ein wirklich liebevolles Zuhause hat.
Wie wichtig ist es Ihnen, das Leben in all seinen Facetten, auch den traurigen, zu zeigen? Auch die schwierigen Seiten der Adoleszenz zu zeigen?
Ich habe mich nicht bewusst dafür entschieden. Diese Dinge sind einfach da. Nicht nur das, was auf die Mädchen zukommt. In Familien, in Bindungen gehen sowieso andauernd Sachen kaputt. Kinder sind überhaupt nicht in Watte gepackt. Wenn immer so gesagt wird, man versucht, alles von ihnen fernzuhalten: Ich wüsste gar nicht, wie. Man kann sie ja nicht nicht rausgeben. Sobald sie im Kindergarten sind, machen sie diese Erfahrung: Dass etwas nur einmal da ist und sie es erst später haben können. Dass Freundschaften kaputt gehen, tut ja auch unglaublich weh. Das ist kein kleinerer Schmerz, als wenn Eltern sich trennen oder ein Hund stirbt. Sie können das später relativieren, aber das ist erstmal total massiv.
Das kann ich nur bestätigen. Unser alter Kater wurde zwanzig Jahre alt. Als er starb, war meine damals achtjährige Tochter untröstlich. Der Kater war ja seit der Geburt meiner Kinder im Haus.
Ja, das war bei meiner Großen mit unserem alten Hund auch so. Sie hat miterlebt, wie er abbaut, es immer schwieriger wird. Und obwohl wir einen neuen Hund haben, vermisst sie den alten. Weil er von Geburt an da war, das ist eine ganz andere Bindung. Da hat man das Gefühl, dass er schon immer da war. Jetzt ist es eine große neue Liebe. Ein junger Hund ist ja sehr dankbar. Der ist jetzt nur eine positive Bestätigung vor allem für meine große Tochter. Sie kommt nach Hause und jemand freut sich halb kaputt. Fragt nicht, wie es in der Schule war, will einfach Spaß haben. Das war mit dem alten Hund alles nicht mehr möglich. Und trotzdem merke ich, dass ihr Herz noch sehr an ihm hängt. Das geht uns auch so. Als die neue Hündin Fanny kam, hat das den alten Hund wieder hochgespült. Dann ist man frisch verliebt, aber man kennt sich ja gar noch nicht richtig. Es ist noch nicht das, was das andere war. Wo man jede Bewegung kennt und man den Hund so genau lesen kann und sich das so eingespielt hat – es ist unglaublich, was das bedeutet.
Tiere zu Wasser und zu Land spielen wieder eine tragende Rolle in Ihrem Roman. Was symbolisiert denn das Ei im Buch, das Charlotte bei ihrem Landausflug von einer alten Frau in die Hand gedrückt wird?
Für mich ist es der Ursprung nicht nur eines bestimmten Lebens, sondern des Lebens überhaupt. Ob es nun um ein Seeungeheuer oder einen Dinosaurier geht, der überlebt hat. Das ist ja auch der Ursprung des Lebens. Wie das Leben überhaupt angefangen hat. Und dass das zu Ende geht, wenn wir die Natur kaputt machen und die Meere kippen. Das Ei symbolisiert überhaupt das Leben auf der Erde. Dass die Dinosaurier ausgestorben sind, dafür können wir nichts. Dass die Seeungeheuer ausgestorben sind, dafür können wir etwas, denn die sind ja immer getötet worden. Sie sind nicht im Dienst des Menschen jemals gezähmt worden. Sie haben den Kopf rausgestreckt und sind erschossen worden und gesunken. Sollte es welche gegeben haben, wurden sie ausgerottet. Oder irgendwelche Fische, die so aussehen, wie wir uns Seeungeheuer vorstellen. Und dieses Ei wäre die Möglichkeit, das wieder zu beleben. Es ist nicht nur, dass wir es beenden, weil wir alles kaputt machen und die Meere dann kippen usw. und da so viel Leben, so viel Sterben dranhängt, sondern dass man vielleicht auch die Möglichkeit hat, so etwas wieder zu beleben. Das wäre ein Wunder, aber das ist eben eine Hoffnung. Auch mit dem Affen ist das sehr groß gedacht – wenn das auch unser Ursprung ist. Für mich spannt das einen großen Bogen von unserem Ursprung bis zu unserem Ende oder unserer Verantwortung, uns um so einen kleinen Affen und ein Ei zu kümmern. Da irgendwie die Kurve zu kriegen. Aber man muss dieses Ei auch nicht so groß sehen.
Greta Thunberg stellte sich mit fünfzehn mit einem Schild vor das schwedische Parlament und demonstrierte für eine gerechtere Klimapolitik. Daraus entwickelte sich die „Fridays for Future“-Bewegung. Macht das Hoffnung: Dass die Kinder und Jugendlichen wieder auf die Straße gehen und die Dinge in die Hand nehmen?
Ja, das ist für mich auch ein totales Wunder, dass das passiert ist. Dass jemand sich da so sehr darauf konzentrieren kann und das so durchzieht, alleine mit einem Schild. Das ist wirklich unglaublich. Die Motivation, dass die Erde weiter besteht, ist logischerweise sehr hoch bei jungen Menschen. Es ist traurig, dass sie das erkämpfen müssen und dass das nicht die Erwachsenen machen. Dass es einfacher ist, zu sagen, ich glaub das nicht oder warten wir auf die Politik. Das ist ja das Tolle an Kindern. Diese unglaubliche Stärke, die in ihnen steckt, dieses: „Will aber, will aber, will aber“. Da kann man argumentieren, was man will – sie bleiben trotzdem dabei, dass sie es wollen. Das ist in den Jugendlichen ja auch noch da.
Ist das auch eine Stärke dieses Alters? Das so durchzuziehen?
Ja, total. Es erinnert mich ein bisschen an die vielen Bewegungen, die jetzt von den Frauen ausgehen. Man hat die unterschätzt und jetzt kommen sie mit so einer Wucht, und man sagt: Könnt ihr das nicht ein bisschen ruhiger und kompromissbereiter machen? Und die Frauen sagen: Aber wir haben jetzt so viele Jahrzehnte und Jahrhunderte gewartet und es ist nichts passiert. Wie lange sollen wir denn noch warten? Und worauf?
Weshalb machen sich die Erwachsenen so gern und so oft über Greta Thunberg lustig?
Selbstschutz. Das ist ein psychologischer Effekt. Zu sagen: Erstens, wir waren das auf keinen Fall. Oder: Wir haben das nicht gewusst, das ist so passiert. Wir kommt man sonst aus so einer Nummer wieder raus, aus dieser Riesenverantwortung? Und das andere ist, das so wegzuschieben und zu verdrängen. Das können die Kinder und Jugendlichen nicht machen, wenn das wirklich die Welt ist, in die sie reingehen. Das Schlimme aber ist, dass es ein Vertrauensbruch ist, wenn die Kinder denken, dass sie das alleine tun müssen.
Was macht gute Kinder- und Jugendliteratur aus? Legt man da andere Maßstäbe an? Hat man da andere Ansprüche an sich selbst?
Ja, total. Ich versuche, Sachen mit reinzubringen, die abgedrehter, anregender sind, als ich sie sonst machen würde. Etwas Schwebendes mit Geistern oder Seeungeheuern. Und ich versuche, den Tempowechsel bei Kinder- und Jugendtexten deutlicher zu machen. Da unterschätzt man sie auch oft. Das kann ruhig atemlos sein, die leben ohnehin in ihrem Konsumverhalten sehr schnell.
Astrid Lindgren meinte einmal, Kinderbücher müssten dieselbe Qualität haben wie Romane für Erwachsene. Und Christine Nöstlinger meinte, sie dürften keine Pädagogikpillen eingepackt in Unterhaltungspapier sein.
Das finde ich tatsächlich schwer. Ich habe auch bei der „Mädchenmeuterei“ vieles wieder rausgekürzt. Auch, weil ich dachte, entweder erzählt das die Geschichte von alleine oder nicht. Es steht ja da. Die Handlung macht das ja.
Die „Mädchenmeute“ ist ja von Rowohlt Berlin nicht immer als Jugendbuch gedacht worden. Die haben das immer ein bisschen verschwiegen. Man hat auch gesagt, ein Jugendbuch würde kein Hardcover bekommen und nicht besprochen werden. Deshalb sagt Rowohlt Berlin, es ist ein Roman. Beim zweiten Teil auch. Weil der erste Teil den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen hat, ist das jetzt klar in der Sparte Jugendbuch. Aber fast mehr als die Hälfte der Leser und Leserinnen sind Erwachsene.
Treffen Sie denn für sich diese Unterscheidung zwischen Jugendbuch und Roman?
Das Buch hat zwei Ansätze. Es gibt sehr junge Leser, die auf das Abenteuerding ansprechen. Und die Erwachsenen lesen es mit Nostalgie. Die Kleineren lesen es nach vorn, die Älteren nach hinten: Das will ich einmal machen oder das hätte ich gern gemacht. Beides ist eine Sehnsucht, aber eine andere. Es wird auch nicht als „Frauenbuch“ gelesen, obwohl „Mädchen“ draufsteht. „Mädchenmeute“ wurde auch von vielen Männern und Jungs gelesen. In den Schulen wird immer wieder mal gefragt: Warum kommen so wenige Jungs in den Büchern vor? Wenn die Hauptpersonen Jungs wären, hätten sie mich nicht gefragt, warum keine Mädchen drinnen sind. Die Jungs, über die Yvette im Buch ganz schön schimpft, sind auch immer sehr daran interessiert, ob ich auch dieser Meinung bin. Bei der letzten Schullesung haben mir aber auch ein paar Jungs recht gegeben: Ja, es gibt schon viele Jungs, die zu brutal und zu hart sind, da kommt man gar nicht ran, die machen immer einen auf cool. Wir aber nicht!
Ist es besonders schön, erfüllend, herausfordernd, für Kinder und Jugendliche zu schreiben?
Am liebsten schreibe ich für Kinder. „Miesepups“ macht mir am meisten Spaß, weil das noch freier ist. Die ganze Welt vom Miesepups ist ja völlig frei. Solange das lustig ist, genug passiert und drollige Lebewesen vorkommen, kann ich da machen, was ich will. Jugendbuch finde ich ein bisschen schwieriger. Da ist immer die Frage, ob man sich gerade vertut. Ob es eben zu verträumt oder zu pädagogisch ist. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Aber ich finde es trotzdem angenehm, dass ich immer hinterfragen muss, wo verfussele ich mich jetzt, weil ich persönlich es schön finde. Wo Erwachsene es so kaufen würden, aber Jugendliche sagen: Hier ist es langweilig. Es ist eine andere Genauigkeit nötig, ein genauerer Blick.
Was ist das Wichtigste, das die Fünf aus der „Mädchenmeuterei“ mitnehmen? Sie „lernen“ ja Dinge, die sehr viel wichtiger sind als das eigentliche Abenteuer, das sie vielleicht anfangs auch gesucht haben. Und sie machen die Erfahrung, dass die Welt sehr komplex ist.
Die beiden Bände bauen aufeinander auf. Das Thema des ersten Teils war Freiheit. Das ist es im zweiten auch, aber Freiheit bedeutet jetzt Verantwortung. Im ersten Teil besteht die Verantwortung darin, wie ich mich annähernd durch den Tag bringe und wo ich in der Gruppe bin. Freiheit bedeutet Verantwortung für mich oder für die Bindung, die ich eingehe, oder für die Hunde, für die ich dann zuständig bin. Je mehr Freiheit man hat, desto mehr Verantwortung hat man. Da muss man so einen Muskel entwickeln, wie man das trägt. Das passiert im ersten Teil. Im zweiten Teil geht es darum, dass die Freiheit, über die wir hier oft reden, oft völlig naiv ist. Dass unsere Freiheit die Freiheit der anderen einengt. Dass wir immer auf dem Rücken der anderen leben. Ob wir auf Urlaub fahren, was wir konsumieren, wie wir so vor uns hindenken und uns selbst finden – das ist völlig an der Realität von vielen anderen vorbei. Da hoffe ich, dass das im zweiten Teil so aufklappt, dass da ja eine ganze Welt drum herum ist. Dass die Mädchen Verantwortung für viel mehr übernehmen müssen. Nicht nur für den Hund, den sie haben, sondern – wenn sie es wirklich ernst meinen – für mehr Tiere, für Konsumverhalten. Dass Freiheit nicht nur bedeutet, wie entscheide ich mich jetzt, wie ziehe ich mich an, wer bin ich. Dass wir nicht das Zentrum sind. In anderen Ländern heißt Freiheit etwas ganz anderes. Da ist das wirklich ein politischer Kampf. Im ersten Teil geht es um die Freiheit der Mädchen, im zweiten geht es um die Freiheit auch der Männer auf dem Schiff und um die Frauen und Familien, die da dranhängen. Den Preis für unsere Freiheit bezahlen oft andere. Wenn junge Leser und Leserinnen merken, dass es so viele Länder gibt, über die sie nichts wissen, wenn sie sich fragen, warum interessiere ich mich nicht dafür, dann reicht mir das als Weg. Im ersten Buch ist die Verantwortung groß. Im zweiten ist sie noch größer.
In „Mädchenmeute“ beschwören Sie eine fast verschwundene Welt herauf (von der meine Töchter nur mehr im Geschichtsunterricht hören). Sie wurden 1977 in der DDR geboren, Ihre Familie, schrieben Sie einmal, war systemtreu. Wie haben Sie diese Zeit Ihrer Kindheit erlebt? Wie haben Sie dann den Mauerfall und die Zeit danach erlebt? Wie hat Sie das geprägt?
Eine Weltsicht wurde über Nacht abgebaut. Und ringsherum sagten alle, sie hätten das gewusst, nur du nicht. Mein Bruder, der drei Jahre älter ist, sagte dann auch, er wusste, dass die DDR nicht gut ist. Die hatten in der Schule in Staatsbürgerkunde Diskussionen, wo Kinder mit Westkontakt andere Sachen sagten. Da gab es dann heiße Diskussionen. Das passierte bei mir alles noch nicht. Für mich ist wirklich – auch wenn ich das immer schwierig finde, zu erklären, aber meistens verstehen die Leute es dann doch – eine Art heile Welt kaputtgegangen. Das ist meine Wahrheit, so hat man mir das gesagt. Und dann sagt man auf einmal: Das stimmt nicht. Ich kam mir vor wie die letzte dumme Trine auf der Welt. Und es ist bis heute schwierig. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das meine Erfahrung mit der DDR war und dass die DDR ein Super-Halunke war, auch wenn ich sie liebhatte. Vielleicht ist es so, wie wenn man über einen sehr geliebten Großvater etwas Schlimmes erfährt. Alle ringsum sagen: Der war ein Schwein, der hat das und das gemacht. Und man sagt: Ja, aber mir hat er immer vorgelesen. Ich muss mich immer daran erinnern, dass ich nicht anfange, die DDR zu verteidigen. Dass ich nicht sage: Aber das Gute war … . Meine große Tochter lernte während der Corona-Zeit zuhause für die Schule über die Wende, DDR und Deutschland. Und das war natürlich eine sehr einfache Darstellung davon. Und für mich war es schwierig, nicht ständig zu sagen: Ja, aber, und: Ich habe das so erlebt. Es wurde dann auch nach Erlebnissen von Zeitzeugen gefragt – Können deine Großeltern, Eltern dir da etwas zur Mauer und zu Berlin erzählen? Und da hat sie mich gefragt, und ich habe gesagt, dass für mich die andere Seite die bedrohliche war. Für mich waren das Arbeitslosigkeit, Drogen, Schießereien, alles, was mir da so erzählt wurde. Aber man kann das nicht so gegeneinander abwägen. Keiner der beiden Staaten wird davon besser, dass der andere schlechter war.
Wie hat das Ihr Verhältnis zu Ihrer Familie geprägt? War es schwierig, das im Nachhinein zu erfahren?
Ich glaube, alle in der Familie waren sehr erleichtert, das nicht mehr leben zu müssen. Es ist ja auch anstrengend, so eine Vision zu halten gegen Widerstände. Wenn man die Realität wahrnimmt, was mit Kollegen passiert, die ihre Meinung sagen, die auch nett sind – mein Vater hatte ganz klar das Gefühl, dass er sein ganzes restliches Leben hier nicht rauskommt. Auch innerlich. Er hat sich sehr gefangen gefühlt in seinem Leben. Gar nicht so sehr im Land mit der Mauer drumherum, sondern eben: Hier wird nichts mehr passieren oder es gibt Ärger. Das heißt, eigentlich war die Familie schon auch eher erleichtert. Alle, die ich kenne in der Familie, hätten sich gewünscht, dass man die guten Sachen der DDR behält, aber es ging dann alles sehr schnell. Wenn man dann eine Demokratie hat und die meisten sagen, sie wollen einfach schnell das und das und das haben, dann passiert das eben. Ich denke immer, wenn man eine große Vision hat, dann wird das immer in der Durchführung nicht gut. Wenn man mit großem Regelwerk und großen Einschränkungen kommen muss – schwierig, das auf eine menschliche Art zu machen. Ich habe durch die Erfahrung immer das Gefühl, dass Gesellschaft etwas Unzuverlässiges ist. Dass ich die Dinge für mich und im Umfeld gut machen kann oder versuche, mich in meinen Texten verantwortungsvoll zu verhalten. Aber dass ich das nicht als Vision verkünden oder belehren kann, weil das immer viele übergeht. Ich habe das Gefühl, dass ich nie in diesem neuen Land gelandet bin. Jetzt wissen wir, was alles schiefgeht. Mit Firmen, Politik, alles, was es an Schweinereien gibt, steht in der Zeitung. Das stand in der DDR nicht in der Zeitung. Jetzt tut es das – und trotzdem passiert nichts.
Ist das nicht fast noch schlimmer? Dass jetzt alles in der Zeitung steht und trotzdem nichts oder zu wenig dagegen gemacht wird?
Ja, das ist absurd. Ich kann manchmal gar nicht zu sehr darüber nachdenken, weil ich sonst das Gefühl habe, ich rutsche völlig ab. Ich nehme schon alles wahr, aber die Frage ist, was ich damit tue. Was ich überhaupt tun kann. Ob ich jetzt hektisch werde und immer alles richtig machen will und immer alle belehre oder ob ich denke, ich kann meine Werte für mich leben und die auch verteidigen. Ich möchte den Kopf nicht verlieren. Und auch nicht den Mut. Wenn ich das alles zuließe, zu denken und zu fühlen, dann würde ich davon mutlos werden.
Wenn ich das richtig heraushöre, haben Sie durch die DDR-Zeit eine Art gesundes Misstrauen entwickelt? Ich finde das nicht das Schlechteste.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es schon ein ganz schöner Einschnitt war. Es ist verwunderlich, dass das nicht ganz offiziell Traumatisierung genannt wird. In meinem Fall ist es eine Beschädigung, von der ich zumindest beruflich wenigstens profitiere. Durch eine andere Wahrnehmung. Ich glaube, das macht es auch mit den Kinder- und Jugendbüchern leichter, weil es da einfach einen Knick bei mir gibt. Da gibt es einen Bruch, an der Stelle ist etwas in der Entwicklung gestört. Deshalb bin ich da näher dran.
Freiheit ist in beiden Bänden ein großes Thema. Würden Sie sagen, dass Sie da durch die Kindheit in der DDR vielleicht nochmals auf eine besondere Weise für dieses Thema sensibilisiert worden sind? Ist Ihnen das ein besonderes Anliegen?
Dass mich das Thema Freiheit so interessiert, kommt, glaube ich, nicht aus meiner DDR-Kindheit, sondern eher aus dem Gefühl, dass es diese Freiheit, von der ich als Kind geträumt habe, gar nicht einfach so gibt. Diese Freiheitsvorstellung war vor allem so etwas wie Wildnis, Entdeckungen, Natur. Dass man einfach loslaufen könnte irgendwohin. Aber eigentlich sind ja überall Städte und Campen ist verboten. Außerdem kommt ja dann sofort die Frage, wovon man leben würde, was essen und so weiter. Aus diesen Überlegungen kommt die Bewegung im ersten Buch. Vielleicht ist es doch ein bisschen DDR, weil die DDR die Indianer als Gegenpart zu den Cowboys verherrlicht hat.
In der „Mädchenmeute“ haben Sie die DDR-Geschichte ja ein bisschen angedeutet. Kommt da noch etwas?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre das nochmals ein Thema für ein Buch. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme. Da schleiche ich immer ein bisschen drum herum.
Wie haben Sie Ihr Erwachsenwerden erlebt, Ihre Adoleszenz?
Das war ja dann schon ein bisschen später. Ich hatte da auch Glück, mich nicht unbedingt über „Bravo“ definieren zu müssen. Dass ich etwas Eigensinniges in mir habe, hat mich geschützt. Ich habe es nicht als großen Druck empfunden, eine junge Frau zu werden. Ich musste mich daran nicht so abarbeiten, ob ich die Schönste bin oder nicht. Die Jungs, die ich mochte, die mochten mich auch. Ich hatte eine relativ einfache Pubertät bis auf das, dass vorher der Mauerfall war und die Scheidung meiner Eltern. Der Bruch ist vorher passiert. In der Familie wurde mir alles Mögliche erzählt, wofür ich noch zu jung war. Das Wachsenmüssen ist ein Stück nach vorne gerutscht bei mir. In der Pubertät war ich ja zu schüchtern, um etwas Krasses anzustellen. Ich bin da sehr sauber durchgekommen. Ich habe dann später Quatsch gemacht, was in Berlin ja geht. Aber dann konnte man die Konsequenzen schon besser abschätzen. Die Pubertät war irgendwie so aufgeteilt. Genau drum herum. Wo sie eigentlich liegt, da war sie bei mir nicht.
Die Digitalisierung unserer Umwelt: Mädchen werden heute mit Bildern konfrontiert, denen sie in der Realität kaum gerecht werden können (sie sollen mindestens Model-Maße haben usw.). Dazu gehört auch die zunehmende Pornographie in unserem Alltag. Wie kann man dem gegensteuern? Wie können Mädchen da zu gesunden, starken, sich selbst wertschätzenden Frauen heranwachsen? Wie ein gesundes Bild von sich selbst aufbauen? Was wünschen Sie sich für Ihre Töchter? Was würden Sie ihnen gerne mitgeben?
Ich versuche eben auch, dass sie sich über sich definieren. Ich glaube, das erleben sie auch bei mir. Es ist eine Menge wert, wenn man das bei der Mutter, Großmutter, bei den Frauen in der Familie hat. Wir haben zuhause nicht so starre Rollenbilder. Mein Mann war lange Hausmann. Und wenn es nötig war, dass ich arbeite, auch so flexibel und selbständig, dass wir das immer teilen konnten. Wenn ich eine Riesenladung Arbeit habe, übernimmt er und ist zuhause auch der Koch und der Bäcker. Ich finde das auch gar nicht mehr so ungewöhnlich. Aber ich weiß, dass es rein zahlenmäßig nicht stimmt. Es ist eine Blase. Da haben es meine beiden Kinder auch leichter. In diesen Zwang reinzugeraten, als Frau, als Mädchen so und so zu sein – das gibt es bei uns nicht.
Seien Sie glücklich! In Österreich ist dieses stereotype Rollenverständnis leider noch weit verbreitet.
Im Kindergarten und in der Schule kommt das dann. Da muss man das begleiten. Ich habe eine große wilde Tochter und eine kleine sanfte. Die große wilde ist vor allem mit Jungs aneinandergeraten. Den Mädchen war sie im Kindergarten manchmal zu wild. Und den Jungs war sie zu stark. Auch jetzt in der fünften Klasse knallt es mit den Jungs auf einmal. Vorher haben sie sich so gekabbelt, da durfte sie immer mitmachen. Das war immer klar, dass sie sehr stark ist und das auch kann, hinterherrennen und sich durchsetzen. Aber jetzt wollen die Jungs sie das nicht mehr machen lassen. Aber wir reden zuhause darüber und unterscheiden: Wer bist du und was wird von außen an dich herangetragen?
Ihre Essays, Kolumnen, aber auch Ihre Kinderbücher, sind formvollendete, großartige Satiren und voller Witz – ich habe selten so gelacht. Nun leben wir (wenn auch nur äußerlich) in politisch sehr korrekten Zeiten, in einer Zeit der „cancel culture“. Ihr Wort dazu? Bleiben da nicht der Humor und die Satire auf der Strecke?
Es gibt Texte von mir, die ich so nicht mehr lesen würde, weil sich Sachen verändern, die ich selber erst gelernt und verstanden habe. Z. B., dass man nicht mehr „dumm“, „blöd“ usw. sagt, weil das Ableismus ist (Diskriminierung oder soziales Vorurteil gegenüber Menschen mit Behinderungen, Anm. d. Red.). Bei der „Mädchenmeuterei“ habe ich versucht, das zu ersetzen durch das, was man wirklich meint. Dass man z. B. „verantwortungslos“ sagt statt „dumm“. Wenn solche Bewegungen der Sprache für mich Sinn ergeben, dann übernehme ich das auch. Meistens ergibt es Sinn. Es ist nicht so, dass das irgendwelche nervigen Leute sind, die das durchdrücken wollen, sondern das sind Menschen, die ihr ganzes Leben lang damit verletzt wurden und damit zu tun haben und sagen, nur weil du das nicht fühlst oder hast, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Meine große Tochter ist schlecht in der Schule und wird auch beschimpft dafür. Und ich sage ihr immer, du lernst auf eine andere Art und Weise. Du bist auf keinen Fall dumm. Der Wunsch wäre ja, dass Wörter nichts Böses mehr sagen, sondern nur eine Beschreibung sind. Wenn man zu jemandem sagt, er ist groß oder klein, dann ist das eine Beschreibung. Aber mit „klein“ beschimpft man jemanden auch schon ein bisschen. Mit „groß“ aber nicht. Mit „klug“ beschimpft man jemanden nicht. Aber mit „dumm“ schon. Oder mit „dick“. Das Gemeine ist, dass es immer eine Hierarche aufbaut. Es sollte nur eine Eigenschaft, eine wertfreie Beschreibung sein. So ist es aber auf dieser Welt nicht. Und das kam in den sozialen Medien gerade hoch, als ich „Mädchenmeuterei“ schrieb. Und ich dachte, oh nein, das nervt mich so sehr. Ich verstehe den Impuls, dass einen das nervt. Dann meckere ich zuhause auch herum: Nichts kann man mehr. Aber dann denke ich nochmals darüber nach, ob ich das verstehe oder ob es nur lästig ist. Und überlege, für wen das aber viel lästiger ist, nämlich für die Betroffenen. Und dass es mich nicht viel kostet, darüber nachzudenken und das verantwortungsvoller zu machen. Ich würde dabei aber nicht verkrampfen oder andere belehren. Ich rede mit Leuten darüber, ohne dass eine große politische Rede daraus wird. Ich habe in meinen Texten oft einen sehr direkten Humor, zumindest in den Texten für Erwachsene. Auch wenn die Mädels miteinander reden, ist es oft sehr schnell und grenzverletzend, und das ist das Lustige daran. Aber ich beobachte das jetzt trotzdem immer, ob das nötig ist oder ob man es nochmals anders machen kann.
Soll man alte Kinderbuchklassiker umschreiben, zensurieren (Pippi Langstrumpf, Preußler …)? Oder sollen Eltern den Kindern das beim Vorlesen einfach erklären? Wie es früher gemeint war und wie man es heute nicht mehr macht?
Das wäre die schönste Lösung, dass das so begleitet wird. Aber da steckt der Wunsch dahinter, dass das alle Eltern machen. Aber das tun sie nicht. Ich würde es nicht entscheiden wollen. Meine Hoffnung wäre, dass das jetzt eine Zeit lang eine Überreaktion ist, eine Übersensibilisierung, und dass sich das dann auch wieder runterfährt. Wie eine Bewegung die sehr weit in eine Richtung geht und sich dann auch wieder einpendelt.
Wie bringt man Kinder, Jugendliche heute überhaupt noch zum Lesen (von Büchern)?
Ich weiß gar nicht, ob man das so düster und pessimistisch sehen muss. Womöglich gab es das immer: Kinder, die viel lesen und solche, die das nicht tun. Nach der Abgabe der „Mädchenmeuterei“ habe ich erstmal auch nichts gelesen, sondern nur Netflix geschaut. Es ist sehr verführerisch, Sachen nur zu gucken. Wenn nicht mehr gelesen würde, dann würde sich mein Berufsstand ändern und ich würde für Filme schreiben. Wichtig ist, dass Geschichten erzählt werden. Natürlich macht Lesen mit dem Gehirn noch etwas ganz anderes. Aber Kinderliteratur boomt doch total. In der Schule, in den Kindergärten wird sehr darauf geachtet und sehr viel gelesen. Im Vergleich zu meiner Kindheit hat das eher zugenommen.
Sie haben „Mädchenmeuterei“ während der Pandemie fertiggeschrieben. Wie glauben Sie, wird sich Corona auf die psychosoziale Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen auswirken? Die Depressionen in dieser Altersgruppe haben stark zugenommen.
Am Anfang hat man ja gehofft, dass Corona wie eine Lupe funktioniert und ganz viele Probleme offensichtlich macht und daraus die Chance entsteht, das zu ändern. Was in den Schulen schiefläuft, in den Familien – man hat es plötzlich so klar gesehen, und jetzt verpufft es so. Ich habe das Gefühl, dass das wieder total versemmelt worden ist. Vielleicht müsste man die Fähigkeit, wie man mit seinen Gefühlen umgehen kann, wie man lernt, dass Verletzungen dazu gehören, viel früher an Kinder und Jugendliche heranbringen. Man muss viel früher lernen, wie man sich stabil hält, nicht erst als Erwachsener. Es ist natürlich total bitter, weil es viele ganz übel erwischt hat, Familien, in denen es Tote gab oder die Langzeitfolgen stark sind. Da ist es dann total ätzend, wenn man da etwas Positives suchen würde. Aber vielleicht schafft es ein Bewusstsein dafür, wie wichtig seelische Gesundheit ist. Dafür, wie instabil wir sind und was nötig ist, uns stabil zu halten. Und dass es insgesamt, ganz allgemein, eine politische Sache ist, wenn zum Beispiel im ganzen Pflegebereich, im sozialen Bereich gespart wird. Ich versuche immer, den Kopf oben zu behalten, stabil zu bleiben, aufrecht. Ich hoffe, dass ich das meinen Kindern so mitgeben kann. Ich weiß aber, dass das bei vielen nicht so ist und dass das an dem Bedarf von vielen Menschen vorbeigeht: Das ist, als ob man zu depressiven Menschen sagt, sie sollen positiv denken. Die brauchen ja wirklich Hilfe. Und eigentlich ist das die Aufgabe des Staates. Das kann nicht immer die Familie tragen oder der Mensch alleine. Und da sind Schulen und alle möglichen anderen Stellen gefragt. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich wütend, also versuche ich, auch daran zu denken, dass die Welt sich insgesamt auf lange Sicht positiv entwickelt. Dass viele Sachen besser sind, als wir sie wahrnehmen. Hoffentlich.
Kirsten Fuchs wurde 1977 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, geboren und ist gelernte Tischlerin. 2003 gewann sie den Literaturwettbewerb Open Mike. Sie schreibt für Kinder (»Der Miesepups«), Jugendliche und Erwachsene (»Die Titanic und Herr Berg«, »Heile, heile«), Satirisches (»Kaum macht man mal was falsch, ist das auch wieder nicht richtig«), Kolumnen für »Das Magazin« und ist Gründerin der Lesebühne »Fuchs & Söhne«. Ihr Roman »Mädchenmeute« brachte den Deutschen Jugendliteraturpreis. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.
—

Kirsten Fuchs
Mädchenmeuterei
Rowohlt Berlin, 496 S.
Kirsten Fuchs
Mädchenmeute
rororo Taschenbuch, 464 S.