Gerd Braune ist ein profunder Kenner der Geschichte und Kultur der indigenen Völker in Kanada. Seit 1997 lebt er in Ottawa und berichtet von dort über das Land, das vielen als „das bessere Nordamerika“ gilt. Sein eben erschienenes Buch „Indigene Völker in Kanada“ ist eine der maßgeblichen Neuerscheinungen des Bücherherbstes und darf schon jetzt als Standardwerk gelten. Das Interview über das Fortwirken des (kolonialen) Unrechts bis heute, den schweren Weg der Verständigung, die Hoffnung auf Versöhnung und das Wirken von indigener Literatur und Kunst. Bild: Emily Carr, „First Nation War Canoes in Alert Bay“ (Ausschnitt), 1912.
Buchkultur: Die First Nations, die indigenen Völker sind durch die Corona-Pandemie besonders gefährdet. Tut Premier Trudeau genug?
Gerd Braune: Wir haben in Kanada ungefähr 1,6 Millionen Menschen, die sich selbst als indigen identifizieren. Das sind vier bis fünf Prozent der Bevölkerung. Wir haben einen hohen Sprung in der Bevölkerungszahl. Das liegt zum einen an dem starken Bevölkerungswachstum in der indigenen Bevölkerung. Das kann in Provinzen mit einem bereits existierenden hohen Anteil dazu führen, dass in 20, 30 Jahren die Mehrheit dort indigen sein könnte. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass unglaublich viele Menschen, die sich früher nicht als indigen identifiziert haben, jetzt sagen: Wir sind native, wir sind First Nations, wir sind Inuit. Das zeigt, dass es ein wachsendes Selbstbewusstsein gibt, sich selbst als indigen zu bezeichnen und das nicht mehr als Stigma in der Gesellschaft zu bewerten. Wenn wir von den 1,6 Millionen die Zahl derer, die in den Städten leben, abziehen, oder die sogenannten „Non-Status Indians“ – wie es nach der besonders problematischen Unterscheidung in dem Gesetz heißt – abziehen, kommen wir vielleicht auf eine Zahl von einer Million. Und wir haben da bisher 450 Covid-19-Fälle und einige wenige Todesfälle. Wir hatten vor ein oder zwei Wochen sechs oder sieben Todesfälle. Aber das ist ungefähr ein Viertel dessen, was der Schnitt der Gesamtbevölkerung ist. Das ist deutlich weniger als in der restlichen Bevölkerung, was bemerkenswert ist. In Italien mussten Patienten in Zelten untergebracht werden. In die abgelegenen indigenen Gemeinden, wo das Gesundheitssystem schwach ausgeprägt ist, die weit abseits liegen, kann man nicht schnell Transporte hinschicken und Zelte hinbringen. Das ist im März, April im hohen Norden nicht möglich. Wie befürchtet wurde und was sich ja auch herausgestellt hat, sind von Covid-19 vor allem die älteren Menschen betroffen. Von den über 9000 Toten, die wir in Kanada haben, sind mehr als 8000 ältere Menschen. Wenn das in den Gemeinden passiert wäre, dann wäre eine ganze Generation, die im Augenblick die letzten Träger von sprachlichen Fähigkeiten, von Traditionen und von Kultur sind, auf einmal weggefallen, gestorben. Das war die ganz große Gefahr: Dass das in einer Zeit, in der es diese Wiederbesinnung, diese Wiederbelebung, diese ersten zaghaften Erfolge zum Beispiel bei Sprachsicherung, bei Traditionswahrung gibt, passieren würde. Die First Nations, die Inuit haben sehr schnell ziemlich radikale Maßnahmen ergriffen und ihre Kommunen, Gemeinden gesperrt, was relativ einfach ist: Man sperrt eine Straße, die nach Norden führt, und dann kommt keiner mehr durch. Oder das Arktisterritorium Nunavut ohne jedwede Straßenverbindung in den Süden, ohne Straßenverbindung von einer der 33 Gemeinden zur anderen – man kann nur per Schiff oder Flugzeug in die Gemeinden kommen – : Die haben mit ihren 35.000 Einwohnern in den 33 Gemeinden bisher keinen einzigen Covid-19-Fall. Das ist bemerkenswert. Das liegt erstens, und das muss immer wieder betont werden, an der sehr schnellen Reaktion der indigenen Gemeinden. Man wollte die Erfahrungen, die man vor einigen Jahren mit der Schweinegrippe machte, wo überproportional viele Bewohner indigener Gemeinden infiziert waren und auch starben, verhindern. Das hat man durch solche Schritte wie das absolute Sperren des Zugangs erreicht. Und dann kam dazu sehr schnell, sofort eigentlich, der Fokus der kanadischen Bundesregierung auf die indigenen Gemeinden durch Finanzmittel, Schutzkleidung, Handschuhe. Es gibt natürlich immer die Aussage, dass das nicht reicht, dass das nicht genug war, dass man mehr hätte machen können. Natürlich hätte man in jeder Phase dieser Pandemie anders und noch besser reagieren können. Aber insgesamt lief da doch viel gut. Dass wir uns jetzt darüber streiten, wie viele Millionen die Bundesregierung für die Wiedereröffnung der Schulen in den Gemeinden zur Verfügung stellt und nicht über Fragen, wie wir das Überleben dieser Gemeinden sichern, ist ja eher ein positives Zeichen. Tut Trudeau genug? Man hätte sicher mehr machen können. Aber insgesamt würde ich sagen, hat die kanadische Bundesregierung sehr, sehr schnell und sehr sensibel reagiert und auch immer in Absprache mit den vier oder fünf großen Organisationen der indigenen Bevölkerung gehandelt. Deshalb stehen wir im Vergleich zu dem, was sich in anderen Ländern tut, gut da.
Die Wiederbelebung der Sprachen ist auch ein großes Kapitel Ihres Buchs. Kanada hat durch eine lange Geschichte der Unterdrückung leider viel dazu beigetragen, dass die indigenen Sprachen verschwinden, z. B. durch die Residential Schools, in denen es den Kindern bei Strafe verboten war, die Sprache ihres Volkes zu sprechen. Wie sehr wirkt das immer noch nach? Wie sehr ist den Kanadiern diese Unrechtsgeschichte bewusst? Was hat sich geändert?
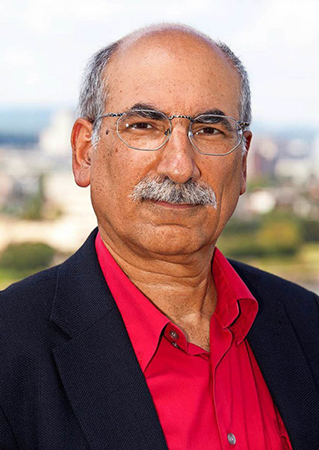
Das ist eine sehr schwierige, pikante Frage. Das Bewusstsein, dass dieses ganze System der Residential Schools wirklich versuchter kultureller Genozid war, dass den Menschen unheimliches Leid zugefügt wurde, ist, glaube ich, in der Bevölkerung mittlerweile breit verankert. Oder sagen wir: Die Kenntnis, dass der kanadische Staat aus heutiger Warte falsch gehandelt hat, dass er den indigenen Völkern Unrecht getan hat – mit dem Entreißen von Kindern aus ihrem Umfeld und diesen rigorosen Maßnahmen des Verbotes, indigene Sprachen zu sprechen, das Abschneiden der Haare, die ein kulturelles Symbol sind. Diese Geschichten – wenn die 70, 80jährigen berichten, wie es ihnen ging, wie sie bestraft wurden – sind schockierend. Diese Aufarbeitung hat Anfang, Mitte der 1990er Jahre begonnen mit diesem ersten Bericht der „Royal Commission on Aboriginal Peoples in Canada“, der das Residential-School-System und was es angerichtet hat, beschrieben hat. Dann kam das erste im Parlament offene Eingeständnis der Regierung, dass da wirklich dramatisch Fehlverhalten passiert ist, dass da eine Politik verfolgt wurde, die aus heutiger Warte wirklich schändlich ist. Mitte der 1990er Jahre begann die Debatte über diesen schlimmsten Exzess, nämlich sexuellen Missbrauch in Schulen. Ich habe aus diesem Grund dieses für mich heute noch bewegende Interview mit dem damaligen National Chief Phil Fontaine wortwörtlich ins Buch übernommen. Da wuchs etwas, und dann kam 2008 die Entschuldigung Stephen Harpers, die man wirklich als historisch bezeichnen muss. Diese Form der Entschädigung der 80.000 damals noch Überlebenden des Residential-School-Systems, die Wahrheits- und Versöhnungskommission, die durch das Land reiste und dann 2015 ihren Bericht vorlegte – so etwas kann nicht an der Bevölkerung vorbeigehen, weil es keine Arbeit im Geheimen ist, wo dann ein Bericht vorgelegt wird, der wieder verschwindet. Sondern es ist etwas, das immer wieder erwähnt wird. Die kanadische Regierung, die Behörde für die Parks Canada, die für Nationalparks und National Historic Sites zuständig ist, hat zwei frühere Residential Schools zu National Historic Sites erklärt. Das sind Stätten, bei denen durch Schautafeln, Hinweisschilder darauf hingewiesen wird, was da passiert ist. Und das ganze Residential-School-System wurde zum Significant National Historic Event erklärt. Was auch bedeutet, dass der Staat insgesamt dies als ein ganz wichtiges Element der kanadischen Geschichte versteht und sich damit auseinandersetzt. Da sieht man, wie an der Aufarbeitung dieser Vergangenheit gearbeitet wird. Das Wissen, dass da etwas wirklich ganz, ganz schief ging, ist weit verbreitet. Die Erkenntnis, das Verständnis, dass das bis in die Gegenwart wirkt, dass das in den Gemeinden Folgen hat bis heute – dass es z. B. ganze Generationen gibt, die von einer sprachlichen Entwicklung, von der eigenen indigenen Sprache abgeschnitten sind, dass Eltern, die als Kinder im Residential-School-System keine Liebe erlebten, gar nicht in der Lage waren, Liebe weiterzugeben, dass dieses Trauma von Generation zu Generation weitergegeben wird –, das ist vielen Kanadiern, aber nicht allen bewusst. Deshalb müssen sich alle noch sehr anstrengen, um auch dieses Bewusstsein, dass das immer noch weiterwirkt, zu stärken. Generell muss man sagen: Ja, man weiß, dass da etwas schieflief. Das Bewusstsein, dass das weitergetragen wird und Probleme bis heute verursacht, ist nicht so sehr ausgeprägt. Was die Wiederbelebung der Sprachen betrifft: Da gibt es ganz viele Bemühungen. Wie die indigenen Völker versuchen, sich das zurückzuerobern – das ist eines der faszinierendsten Elemente der Bildung und Sprache. Der Aufbau eines eigenen Schulsystems, das indigene Werte vermittelt, ist da noch einmal einfacher als eine fast verschwundene Sprache wiederzubeleben. Gerade bei Völkern, wo nur noch die ältere Generation diese Sprachen spricht, gibt es Hoffnung machende Indizien, dass es zumindest bei einigen Sprachen gelingen wird, die dauerhaft zu sichern beziehungsweise wiederzubeleben. Und wenn es nur ist, dass man weiß, es gibt diese Sprache und es gibt Menschen, die immer weniger fließend sprechen. Es ist hochinteressant, Statistiken zu lesen, dass in einigen indigenen Völkern der Kreis derer, die die Sprache sprechen, größer ist als der Kreis derer, die es als Muttersprache, als erste Sprache, sprechen. Es gibt sehr viele gerade junge Menschen, die eine indigene Sprache jetzt wieder gelernt haben und nicht quasi mit der Muttersprache aufgesogen haben.
Indigene Literatur wird aber vorwiegend auf Englisch oder Französisch verfasst?
Ja.
Es wäre vermutlich auch nicht möglich, so wie sich der Literaturmarkt heute präsentiert?
Wenn wir sagen würden: Kanada hat Englisch, Französisch und eine indigene Sprache – dann wäre das möglich. Aber Kanada hat ungefähr sechzig verschiedene indigene Sprachen. Jede ist anders, manche haben ihre eigenen Schriftzeichen entwickelt. Ein Literat, ein Schriftsteller, der in der eigenen Sprache schreiben würde, hätte einen so geringen Markt – damit würde er nicht durchdringen. Fakt ist, wenn diese Autoren wirken wollen und etwas bewirken wollen, dann schreiben sie auf Englisch oder Französisch. Das sind ja auch alles sehr gebildete Menschen, die diese Werke publizieren, bei Lesungen oder als Künstler auftreten. Die beherrschen natürlich Englisch und Französisch aus dem Effeff.
Gelingt es ihnen, sich bei uns, bei den nichtindigenen Lesern, damit Gehör zu verschaffen, auf ihre Probleme, Belange aufmerksam zu machen? Etwas zu bewirken?
Auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Diese Werke finden solche Resonanzen im Kreis derer, die sich für Literatur und für dieses Thema interessieren, die sich aktiv damit auseinandersetzen. Natürlich ist es nur ein geringer Prozentsatz der kanadischen Bevölkerung, die wirklich Detailkenntnis hat und Schriftsteller nennen kann.
Das Wiederbeleben der Sprachen, das Aufblühen der indigenen Kunst und Kultur – hat das auch mit der „Idle No More“-Bewegung zu tun?
Bis in die Sechzigerjahre waren die indigenen Völker in Kanada Objekt des Handelns der Regierungen, im Grunde ein Opfer. Das muss man nicht nur negativ sehen. Aber sie waren nicht diejenigen, die über ihr Schicksal entschieden haben. Sie waren die Mündel, die Abhängigen. Der Staat hat im Rahmen dessen, wozu er gesetzlich verpflichtet war, mehr oder weniger gut für sie gesorgt und für sie gehandelt. Und dann kam dieser Politikvorstoß des von mir generell sehr geschätzten Pierre Trudeau – die „White Paper Policy“. Er hat gesagt, wir schaffen dieses ganze System, den „Indian Act“, Reservationen usw., ab. Wir wollen – das war die gute Intention ¬– die indigenen Völker, die bisher so einen großen Rückstand im Lebensstandard hatten, an unseren Lebensstandard heranführen, und das erreichen wir am besten, indem wir sie wirklich integrieren. Und zwar nicht in dem Sinne, wie es hundert Jahre zuvor durch den damaligen Premierminister John A. Macdonald und die anderen Politiker geschehen ist – durch Verbot von Sprache usw. –, sondern indem wir sagen: Ihr seid erst einmal gleichgestellt mit uns, diese ganzen Sondervorschriften machen wir weg und sehen, dass wir zusammen vorankommen. Und dann wachten die auf und sagten: Augenblick mal, das ist ja eine gute Intention, aber langfristig gehen wir dann in der Gesellschaft unter – „You want to make brown skins white men“. Das war Ende der Sechzigerjahre der Auslöser. Diese „White Paper Policy“ führte dann dazu, dass sich wirklich eine ganz starke Bewegung für indigene Rechte gebildet hat. Das Interessante ist, dass das parallel zu der 68er-Studentenrevolution in Europa verlief, zum Widerstand in den USA gegen Vietnam – dieses Auflehnen gegen Autoritäten. Einer der ersten Ansätze war die Schaffung von starken Interessensorganisationen, -verbänden, – das hieß damals „National Indian Brotherhood“. Eine der ersten Initiativen war das Schulsystem: „Indian Control of Indian Education“. Das sagt ja etwas aus, dass das noch als Basispapier genommen wird für all das, was sich im Bereich von Kultur, Bildung, Sprache usw. tut. Und parallel dazu der Kampf um Landrechte vor den Gerichten. Diese beiden großen Ströme führten zu diesen langsamen, aber doch deutlich sichtbaren Fortschritten in Kanada. Es gibt immer wieder die Phasen des ruhigen, nicht so aufregenden Fortschritts – aufregend in dem Sinn, dass es Schlagzeilen über Auseinandersetzungen verursacht –, und dann gibt es die Phasen des Protestes. Das sind diese schlimmen Konflikte der 1990er Jahre: die Oka-Krise, die Auseinandersetzung zwischen den First Nations und der Polizei oder sogar dem Militär (1990 führten in Oka, Provinz Québec, Pläne der Gemeinde, einen Golfplatz auf Gelände der Mohawk von Kanesatake, zu dem auch ein Friedhof gehörte, auszuweiten, zu einer 78-tägigen Konfrontation zwischen der Staatsmacht und den Mohawk von Kanesatake, Anm. d. Red.). Auf der einen Seite sprach die damals konservative kanadische Bundesregierung durch Stephen Harper diese wirklich beeindruckende Entschuldigung aus. Die muss man immer wieder lesen, um zu begreifen, was da passierte. Das ist wie das Schuldbekenntnis der Evangelischen Kirche in Deutschland angesichts ihrer Rolle im Holocaust: „Wir haben geschwiegen“. Das hat für mich die gleiche Dimension. Man soll ja solche historischen Ereignisse nicht vergleichen. Aber es ist schon eine Leistung für einen Staat, das so auszusprechen. Andererseits hat er aber auch eine Politik betrieben, die immer wieder zurückfiel in dieses Schema: „Wir wissen am besten, was gut für euch ist“. Er hat dann Gesetze vorgelegt über die Änderung von Finanzen, über Regierungsstrukturen usw., wo man nicht ausreichend auf die indigenen Völker hörte. Ihre Ansichten wurden nicht ausreichend berücksichtigt. Das war dann 2012 auch ein Auslöser für die „Idle No More“-Bewegung – zusammen mit dem immer wiederkehrenden Bewusstsein, da gibt es diese sozialen Krisen in den Gemeinden – verschmutztes Wasser, verrottende Häuser, Arbeitslosigkeit, Suizid. Und jetzt völlig überraschend der Protest gegen den Bau einer Erdgaspipeline auf dem Territorium des Volks der Wet’suwet’en in der westlichen Provinz British Columbia. Und bei Kingston wird die wichtigste Eisenbahnverbindung zwischen Toronto und Montreal blockiert. Das sind dann solche immer wiederkehrenden Ereignisse, die auf der einen Seite eine Bedrohung für diesen Prozess der Verständigung darstellen, weil viele Kanadier sagen: Wir tun doch so viel für euch, aber ihr riskiert wegen eines Projektes die Eisenbahnlinie und Hunderte von Menschen verlieren ihre Arbeit. Das ist wirklich ein schwieriges Feld: Ist das jetzt ein Fortschritt? Ist das im Rahmen dieses Prozesses immer wieder als Brennholz notwendig, um die Flamme aufrechtzuerhalten? Oder ist es eher ein Eimer kaltes Wasser, der das Feuer erlöschen lässt?
Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass der Begriff „Land“ für die indigenen Völker etwas gänzlich anderes bedeutet als für die Weißen Menschen, deren Kulturbegriff vom Fortschritt, Wachstum etc. geprägt ist?
Das ist teilweise richtig. Ich sage teilweise, weil es auch innerhalb der indigenen Bevölkerung – das zeigt sich bei allen Wirtschaftsprojekten – genau die gleichen Konfliktlinien gibt wie in der restlichen Gesellschaft. Dass es sogar innerhalb dieses kleinen Volkes von wenigen Tausend Menschen gibt, die sagen, wir brauchen diese Pipeline, es schafft Arbeit und wir können das vereinbaren mit dem, was wir an Werten, Umweltschutz, an Vorkehrungen wollen. Wir wollen vor allen Dingen Arbeitsplätze haben. Und es gibt Menschen, die sagen, das ist unser traditionelles Gebiet und das schützen wir jetzt erstmal, und die dann der Regierung vorwerfen, dass sie über ihre Rechte trampelt. Wir wollen diese Pipeline in der Form nicht. Aus europäischer Sicht, aber auch aus der Sicht vieler Kanadier, ist es zu einfach, das als Konflikt zwischen denen, die für den Umweltschutz sind, und der restlichen Bevölkerung, die Wirtschaftsinteressen hat, die die Bedeutung solch großer Entwicklungsprojekte betonen, zu sehen. Alle Konfliktlinien, die wir in der Gesellschaft haben, finden wir auch innerhalb der indigenen Bevölkerung. Das ist besonders stark bei den First Nations, weil das eben 600 verschiedene sind. Es ist viel einfacher, im hohen Norden etwa mit den Inuit einen Vertrag auszuhandeln und ein Projekt durchzuziehen, weil die Strukturen klar sind und es eine relativ homogene Gruppe ist. Über ein Territorium von 2 Millionen km2. Da hat man die drei, vier Regionalorganisationen, da hat man die 30 Gemeinden, und man verhandelt jeweils im eigenen Benefitabkommen mit ihnen und kommt zu einer Verständigung. Wenn sie aber hierorts über 500 km eine Pipeline führen, berühren sie direkt die Gebiete von zehn verschiedenenen indigenen Völkern und dann nochmals zehn, zwanzig, die am Rande sind und die auch indirekt oder direkt betroffen wären. Man muss unheimlich viel Geduld haben und guten Glaubens verhandeln. Man muss genau erklären, und das ist sowohl für die indigene Bevölkerung ein Erfahrungsprozess, aber auch für eine Bürokratie, die bis 2010, 2012 noch ganz anders gehandelt hat, ein völlig neuer Ansatz und eine neue Erfahrung und unheimlich schwer.
Auch wenn die Frankfurter Buchmesse nun nicht wie ursprünglich geplant, stattfinden kann: Welche Symbolkraft hat der zumindest virtuelle gemeinsame Auftritt aller Kulturschaffenden Kanadas: der englischen, der französischen und der indigenen? Dass man gemeinsam auftreten will? Ist das ein gutes Zeichen auf dem Weg der Versöhnung?
Ich halte das, was hier geplant war – auch das Motto „Singular Plurality“, das die Kanadier so in den Vordergrund gestellt haben –, für ein ganz, ganz wichtiges Signal. Vor fünfzig Jahren hätte man nur von Englisch gesprochen, dann hat man jahrzehntelang von den beiden Gründernationen, von den Anglo- und Frankokanadiern, gesprochen, und nicht einmal von den drei Säulen. Was für mich auch sehr wichtig ist in meinem Buch, auch wenn es relativ knapp abgehandelt ist im Kulturteil, ist diese Einrichtung des Nationalen Indigenen Theaters. Stellen Sie sich vor, Sie hätten in einer der großen Kulturorganisationen in Wien auf einmal so etwas. Es gibt keine indigenen Völker in Österreich. Aber es ist so eine plurale Gesellschaft. Stellen Sie sich vor, man macht einen extra Zweig mit Veranstaltungen, Finanzierung, mit Räumen, Personal, die sich speziell mit all den multikulturellen Gesellschaften, die nach Österreich eingewandert sind, beschäftigen. Es ist schwer zu vergleichen, weil das ja nicht die Urbevölkerung ist. Aber dass das National Arts Centre in Ottawa neben der Anglo- und Frankosäule eine dritte Säule geschaffen hat mit einem eigenen Direktor, der indigene Kultur vertritt, ist faszinierend. Bis in die 1960er Jahre wurde diese Kultur unterdrückt, versucht, auszulöschen. Und jetzt steht auf einmal im National Arts Centre „Indigenes Theater“ auf der Website, und man sieht diese Künstler – Buffy Sainte-Marie, die aus der Cree-Reservation Piapot in Saskatchewan stammende Sängerin, Gitarristin und Pianistin, Kehlsängerinnen, Schriftsteller, der Zirkus, der dann kommt, usw. – es ist unglaublich, was man da an Veränderungen sieht. Und man sieht auch, dass es nicht nur billige Lippenbekenntnisse sind – das ist auch mit viel Geld verbunden –, und dass es im Kreis derer, die sich für Kultur interessieren, Wirkung zeigt. Deshalb finde ich auch den geplanten Auftritt bei der Buchmesse unheimlich wichtig. Dass auch der Außenwelt gezeigt wird, indigene Völker – das sind nicht nur der kleine „Eskimo“, der im Kajak sitzt und mit dem Speer Robben jagt, und der Indianer im Kopfschmuck, der beim Powwow auf der Wiese tanzt oder die Friedenspfeife raucht – all diese schrecklichen Klischees, die wir in Europa haben –, sondern sie sind ein ganz wichtiger Teil des Gegenwartskanadas. Dass man eben nicht sagt: „Indigen“ – das ist so eine Reservation ganz abseits, das lassen wir unangetastet, weil es so schön in unsere Klischees passt. Sondern es ist Teil einer Gesellschaft, es lebt, es verändert sich auch. Gestern war ein interessanter Beitrag im Radio, in dem eine indigene Frau gefragt wurde, was sie denn am meisten im Gespräch mit nichtindigenen Menschen stört. Und sie antwortete, es sei die Frage: Sind Sie indigen? Sie sehen ja gar nicht so aus! Weil sie eben nicht die langen schwarzen Haare hat usw. Ich habe einen guten Freund, der Professor hier in Ottawa ist. Er kommt aus einer First Nation in Québeq. Er ist hundert Prozent First Nation. Wenn Sie ihn sehen, kommen Sie auf alle möglichen Gedanken, aber nicht darauf, dass er First Nation ist. Wir müssen uns davon lösen, dass das so eine ganz separate Gruppe ist durch Aussehen, durch Tradition, durch Geschichte. Die indigenen Völker sind wirklich Teil der Gesellschaft, wirken in die Gesellschaft hinein. Sie erhalten ihre Tradition, ihre Kultur, ihre Denkweisen, ihre Sprachen und ihre Rechte am Land aufrecht, und sind trotzdem Teil der Gesellschaft. Es ist ein schwerer, sehr, sehr diffiziler Prozess. Die Frage, ob das am Ende wirklich zu einem Erfolg führt, ist eine sehr schwere. Es ist auch die Frage, was man als Erfolg definiert. Für mich zeigt sich Erfolg dann, wenn es gelingt, Kultur und Sprache zu erhalten und den Gap im Lebensstandard der Gemeinden zu überbrücken. Dass wir nicht mehr diese großen sozialen Probleme, die Gesundheitsprobleme in den Gemeinden haben. Wenn es uns gelingt, diese Kluft zu schließen, wenn das zum Erfolg führt, dann können wir froh sein. Aber das ist ein Prozess, der sich noch über Jahrzehnte erstrecken wird. Wenn die Regierung und die nichtindigene Bevölkerung da nicht wirklich dahinterstehen, dann dauert es länger. Die indigenen Völker lassen sich nicht einmal mehr auf den Stand von vor zwanzig Jahren zurückwerfen. Ihre Rechte sind in der Verfassung verankert. Sie haben ihre Verträge, ob es die historischen sind oder, ganz wichtig, „modern day treaties“ – da gibt es kein Zurück mehr. Zu sagen, wir sind eine Gesellschaft von Anglo- und Frankokanadiern und alles andere interessiert uns nicht mehr, läuft in Kanada nicht mehr.
Genau das war meine letzte Frage: Wie kann Versöhnung, Reconciliation, ein respektvolles Miteinander, eine gemeinsame Zukunft gelingen? Wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass das gelingt?
Es wird noch dauern. Wir sind noch nicht in einer Phase, wo es von beiden Seiten ein Geben und Nehmen ist. Wir sind noch in einer Phase, in der der Staat noch viel tun muss, um Fehler der Vergangenheit auszugleichen. Wenn wir ungefähr auf gleicher Ebene sind, was Rechte, soziale Bedingungen und Kultur angeht, dann kann man darüber sprechen, dass man wirklich einen gemeinsamen Weg geht. Wie zwei Schiffe, die nebeneinander auf gleicher Höhe fahren.
—

Gerd Braune, „Indigene Völker in Kanada“
(Ch. Links Verlag), 272 S.













